Hier findest du eine bunte Sammlung meiner Texte – Gedichte, Gedanken und kleine Fundstücke aus dem Alltag. Manche sind leise, andere laut, einige voller Fragen, andere wie Antworten. Sie alle sind Teil meines Weges und vielleicht auch ein Stück deines. Lass dich treiben, lies querbeet oder bleib bei den Worten hängen, die dich gerade berühren.

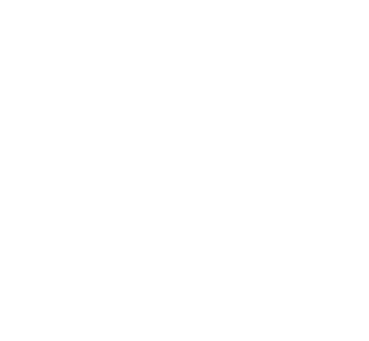
Es war eigentlich keine große Sache.
Keine Eskalation.
Nur eine simple Nachricht.
Ein paar Worte, die auf meinem Bildschirm aufploppten.
Sachlich. Kurz.
Und doch merkte ich es sofort.
Wie es in meinen Fingerspitzen zu kribbeln begann.
So ein leichter Strom.
Kennst du das, wenn sich die Luft kurz vor einem Gewitter statisch auflädt und es auf der Haut prickelt? Genau so.
In meinem Bauch zog sich etwas zusammen, ein Rumoren,
das nichts mit Hunger zu tun hat.
Und in meinen Schläfen baute sich ein feiner Druck auf.
Nicht sichtbar. Aber da.
Der Körper reagiert schneller als der Verstand.
Und zack, es passiert doch wieder.
Mein Körper kennt diese Geschichte schneller als ich.
Noch bevor ich dachte, war ich mitten in den Fragen.
War ich zu viel? Zu klar? Zu anspruchsvoll? Nicht gut genug?
Nicht genug?
Erstaunlich, wie schnell sich etwas Fremdes in einen hineinlädt. Wie ein automatischer Download. Ungefragt. Direkt ins System.
Und ich fragte mich:
Wer entscheidet eigentlich über mein Inneres –
ich oder mein täglicher Download?
Es ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebe.
Vor Jahren, bei einer Bewerbung für ein amerikanisches Unternehmen, musste ich Referenzen angeben. Drei privat. Drei beruflich.
Es fühlte sich an, als würde ich mein Leben von außen erklären lassen.
Was dann zurückkam, hat mich mehr als überrascht.
Man beschrieb mich als klar. Präsent. Durchsetzungsfähig. Kollegial. Verlässlich. Empathisch. Als jemand, der Menschen wirklich sieht.
Ich saß da und dachte:
Meinen die mich?
Ich bin doch einfach nur ich.
Ich mache mein Ding.
Ich arbeite.
Ich höre zu.
Ich schreibe.
Ich bin.
Aber dann fiel mir etwas auf.
Mehrere sagten unabhängig voneinander:
„Wenn sie mit jemandem spricht, ist sie ganz da.“
Ich schaue Menschen direkt an. Wenn ich im Dialog bin, gibt es kein rechts und kein links. Keine Ablenkung. Kein Nebenbei.
Mein Gegenüber ist dann im Mittelpunkt. Echt. Wichtig.
Für mich fühlt sich das selbstverständlich an. Vielleicht ist es genau dieses innere Leuchten, das andere wahrnehmen.
Wenn ich mich richtig dolle freue, wenn ich glücklich bin,
spüre ich es körperlich.
Es beginnt im Brustraum, breitet sich aus wie eine Vibration. Mein ganzer Körper pulsiert, als wolle er noch mehr Echtes, noch mehr Tiefe. Noch mehr Leben.
Und ich sehe dieses Leuchten auch bei anderen – in ihren Augen, besonders, wenn sie für etwas brennen.
Vielleicht ist das meine eigentliche Stärke.
Nicht Lautstärke.
Sondern Präsenz.
Und trotzdem reicht eine einfache Nachricht – und mein System reagiert.
Ein alter Download meldet sich.
Die Suche nach Anerkennung. Gemocht werden. Nur nicht anecken.
Zu hohe Ansprüche, die ich an mich selbst stelle.
Nicht, weil sie jemand laut formuliert hätte.
Sondern weil sie sich über Jahre – um fünf Ecken – mitten hinein eingeschlichen haben. Vielleicht aus meiner Herkunft. Vielleicht aus meiner Erziehung. Vielleicht aus Beziehungen, in denen ich mich angepasst habe.
Ich habe viel geschluckt in meinem Leben.
Respektlosigkeit – als Verständnis getarnt.
Wenn jemand die Stimme senkte und diesen Ton bekam, dachte ich:
Er hatte sicher einen stressigen Tag. Sie meint das nicht so. Vielleicht bin ich zu empfindlich.
Ignoranz – als Geduld verkauft.
Wenn ich merkte, dass mein Satz im Raum einfach verpuffte, blieb ich ruhig. Wartete. Hielt aus.
Dabei fühlte ich mich längst klein.
Niemand hatte mich dazu gezwungen.
Und ich redete mir auch noch ein, das sei Reife.
Heute nicht mehr.
Je älter ich werde, desto deutlicher spüre ich mein Nein.
Es sitzt nicht mehr im Kopf. Es sitzt im Körper.
Ein klares Zusammenziehen. Ein inneres: bis hierhin und nicht weiter. Stopp.
Und doch – eine Nachricht. Ein paar Worte.
Und alles will sich doch tatsächlich kurz wieder KLEIN machen.
Unterdessen erkenne ich es. Das Muster.
Bin ich fremdgesteuert durch Erwartungen? Durch Social Media, wo jeder Upload perfekt gefiltert wirkt? Durch Rollen, die andere mir zuschreiben? Durch das alte Bedürfnis, es allen recht zu machen?
Oder bin ich die, die entscheidet?
Was passiert, wenn mein Upload nicht mehr zu meinem Download passt?
Dann entsteht Reibung. Im Kopf. Im Bauch.
Spannung in meinem Herzen.
Und dann stell ich mir die Frage:
Vielleicht ist genau dieses Reiben Entwicklung.
Vielleicht bin ich nicht das Produkt meiner Prägungen.
Nicht die Summe fremder Meinungen.
Nicht die Figur meines Umfelds.
Vielleicht bin ich eine Schnittstelle – zwischen dem, was ich aufgenommen habe, und dem, was ich bewusst weitergebe.
Nicht jede Nachricht ist eine Wahrheit.
Nicht jede Erwartung ein Auftrag.
Nicht jede Reaktion ein Maßstab.
Ich darf wählen, was bleibt.
Ich darf löschen.
Ich darf überschreiben.
Ich darf neu formulieren.
Resetten, wenn ich will.
Und ich darf anerkennen oder ablehnen, was andere in mir sehen, ohne mich davon abhängig zu machen.
So eine Nachricht wie diese von heute hat sicherlich nichts zerstört.
Sie hat mir nur wieder gezeigt, wie sensibel mein System reagiert.
Nur, ich bin nicht mehr das kleine Mädchen, das allen gefallen muss.
Ich bin nicht mehr die Frau, die Respektlosigkeit übergeht.
Ich bin nicht mehr das Echo fremder Stimmen.
Ich bin nicht das Produkt meiner Downloads.
Ich bin die Autorin meines Uploads.
⭐ WEIHNACHTSGESCHICHTE
Ich erinnere mich an diesen Winter, als wäre er gestern gewesen. Nicht wegen des Schnees, nicht wegen der Lichter – sondern wegen ihm. Teddy Balu.
Ich war sieben oder acht, noch jung genug, um an Wunder zu glauben. Für mich war Weihnachten damals ein Ort, kein Datum. Ein Ort, der nach selbstgebackenen Vanillekipferln, Zimtsternen, Kerzenwachs und dem rauchig-harzigen Duft unseres Kaminfeuers roch. Ein Ort voller Sehnsucht, Hoffnung und diesem warmen Kribbeln im Bauch, das versprach: Dieses Jahr passiert etwas Großes.
Und dieses „Große“ stand im allerschönsten Weihnachtsfenster im Warenhaus unserer kleinen Stadt. Künstlicher Schnee fiel von der Decke wie in einer nie endenden Schneekugel. Ein hölzerner Schlitten war beladen mit glitzernden Paketen. Lichterketten blinkten, Engel aus Goldpappe lächelten, und eine Spieluhrmelodie vibrierte durch die Scheibe.
Aber ich sah nichts davon.
Ich sah nur ihn.
Den größten, weichsten, schönsten Teddybären der ganzen Welt. Beige, flauschig, mit runden Pfoten und Augen, die mich so direkt anschauten, wie nur ein Kind es sehen kann.
Ich drückte meine kleine, kalte Nase an die Fensterscheibe. Meine blauen Augen glänzten wie Weihnachtskugeln. Meine blonden Locken waren zu hohen Zöpfen geflochten, welche selbst mit Pudelmütze auf dem Kopf, bei jeder Bewegung mithüpften.
Mama stand hinter mir und lächelte ihr warmes Mama-Lächeln. „Der ist aber groß. Mindestens so groß wie du“, sagte sie.
Er war so groß, dass ich mich ganz in ihn hineinkuscheln konnte und wirklich glaubte, er würde auf mich aufpassen.
Für mein Kinderherz war er kein Spielzeug – er fühlte sich an wie der Freund, den ich mir fürs ganze Leben wünschte.
Ich war klein, aber die Sehnsucht war groß.
So groß, dass sie in meinem Bauch brannte.
So groß, dass ich beim Einschlafen seinen Namen dachte, obwohl er keinen hatte.
Ich wollte keine Puppe. Keine Schokolade. Keine Spiele. Ich wollte nur ihn.
Zu Hause nahm ich einen Zettel. Ich schrieb „Teddybär“ in Schönschrift, malte ihn mit dicken Umrissen, runden Ohren, einem Lächeln – und natürlich Herzen. Überall. Ich hatte schon damals dieses Ding mit Herzen, als wollte ich dem Christkind zeigen, wie viel Liebe in diesem Wunsch steckte.
Ich war überzeugt, dass mein Wunschzettel ins Himmelspostamt schwebt, wo jemand nickt und sagt: „Alles klar. Das Kind braucht genau DEN.“
Mama verstärkte meinen Glauben. In der Vorweihnachtszeit war sie oft unser eigenes Christkind. Sie zog ein weißes Nachthemd an, setzte eine gelockte Engelperücke mit einem wackeligen Heiligenschein auf und sagte mit ihrer Dezember-Stimme: „Ihr müsst ganz leise sein. Ich bin beim Weihnachtsdienst. Nicht stören.“
Und dann wurde sie zur Helferin des Christkinds. Das war nicht gespielt. Nicht für mich. Das war echt. Wenn Mama so dastand, war Weihnachten möglich. Alles war möglich. Mein Teddy war möglich.
„Ich bringe deinen Wunschzettel gleich ins Christkind-Büro“, sagte sie. Und ich glaubte ihr jedes Wort.
Doch jedes Mal, wenn wir in der Stadt waren und am Warenhaus vorbeigingen, saß der Teddy immer noch dort. Auf seinem Schlitten. Unberührt. Unerreichbar.
„Ah… da sitzt er ja noch“, sagte Mama verwundert und zog die Augenbrauen ein wenig hoch – so, wie Eltern schauen, die etwas wissen, aber nichts verraten dürfen. „Wer weiß, für welches Kind er gedacht ist…“
Dieser Satz tat weh. Es fühlte sich an, als würde etwas in mir kurz absinken, ein Gefühl von: Vielleicht bin nicht ich gemeint. Vielleicht ist Weihnachten dieses Jahr anders. Vielleicht… nicht für mich.
Und für einen Moment dachte ich:
Weihnachten ist kaputt. Einfach kaputt.
Ich schlich am Schaufenster vorbei, tat so, als wäre es mir egal, aber in mir brannte mein kleines Herz.
Ich war enttäuscht.
Wütend.
Traurig.
Dieses Kinder-Mischgefühl, das keiner versteht, weil man noch keine Worte dafür hat und es trotzdem viel zu deutlich spürt.
Ein paar Tage vor Heiligabend war meine Oma zu Besuch. Mama packte mit ihr im Elternschlafzimmer Geschenke ein, ich hörte Rascheln, Lachen, Papierknistern.
Und plötzlich war da dieses eine Gefühl, das stärker war als ich selbst: Neugierde.
Ein lautes Gefühl. Eines, das Türen öffnet – und Magie nimmt.
Als Mama mit Oma später im Wohnzimmer - gemütlich bei Plätzchen und Pfefferminztee - saß, schlich ich ins Schlafzimmer. Mit einem großen Betttuch zugedeckt, lagen die Geschenke gestapelt.
Ich hob das Tuch an und sah die Päckchen: für Oma, für Papa, für Mama, für meine kleine Schwester – und einen Stapel für mich.
Mehrere unterschiedlich große und kleine Päckchen lagen dort, jedes in anderes Geschenkpapier gewickelt, bunt und weihnachtlich, manche mit Schleifen, manche mit glänzenden Bändern.
An jedem hing ein kleiner Namensanhänger – und alle Geschenke in meinem Stapel trugen meinen.
Ich setzte mich davor. Herzklopfen. Aufregung. Schuldgefühl.
Und dann … ein ziemlich großes Paket. Unförmig, weich, raschelnd. Es stupste fast zurück, wenn man es berührte. Es war das Versprechen eines Wunders.
Meine Hände zitterten als ich den Tesastreifen ganz vorsichtig, ganz langsam löste. Ich schob das geöffnete Geschenkpapier unten ein kleines Stück zur Seite und öffnete den Boden gerade so viel, dass man hineinschauen konnte.
Und da war er.
Der Teddy.
Mein Teddy.
Der aus dem Schaufenster.
Ich hielt meinen Weihnachtswunsch in den Händen.
Ich klebte das Paket wieder zu.
Schief.
Sichtbar.
Hoffend, dass es keiner merkt.
Und kaum war das Papier wieder zu, spürte ich dieses seltsame Ziehen im Bauch – ein Gefühl, das man als Kind bekommt, wenn man etwas getan hat, das man eigentlich nicht wollte, aber trotzdem getan hat.
Es war, als hätte ich einen kleinen Riss in die Weihnachtsmagie gemacht, einen so winzigen, dass ihn niemand sah – außer mir.
Heiligabend war wie ein Bilderbuchabend.
Wohin man auch sah, glitzerte und glänzte es: Kerzen brannten, ihr Licht spiegelte sich in Fenstern und Glaskugeln, und der Weihnachtsbaum reichte fast bis zur Decke. Große, schimmernde Kugeln hingen darin, Lamettafäden und dazwischen selbst gebastelte Strohsterne. Alles war festlich, warm und voller Erwartung.
Ich trug mein bordeauxrotes Samtkleid, weiße Strumpfhosen und bordeauxfarbene Lackschuhe.
Meine kleine Schwester zappelte ungeduldig, hübsch anzusehen,
in einem kirschroten Overall.
Mama sah aus wie der Engel, den sie immer spielte. Nur diesmal ohne Perücke und in einem edel glänzenden, grünen Taftkleid.
Meine Oma saß auf dem Sofa, lächelte still und freute sich, diesen Abend mit uns zu teilen. In ihrer Hand hielt sie ein Glas selbstgemachten Weihnachtspunsch – nach ihrem geheimen Rezept, das es nur an Heiligabend gab.
Papa, ungewohnt geschniegelt in einem dunkelblauen Anzug mit Krawatte, filmte alles mit seiner Super-8-Kamera: jedes Detail, jede Bewegung, jeden kleinen Moment.
Er bannte Erinnerungen für die Ewigkeit auf Celluloid.
Unter einer goldgesprenkelten Sternendecke lagen verhüllt vor neugierigen Kinderaugen, die Geschenke. Die Bescherung begann immer dann, wenn Papa mit der Weihnachtsglocke bimmelte und im Hintergrund „Stille Nacht, heilige Nacht“ aus der Box des Plattenspielers erklang.
Ich bekam ein Avon-Täschchen mit kleinen Mini-Pröbchen, Lippenstifte und blauem Lidschatten – ich liebte das schon damals. Katzenzungen Schokolade. Und einen rosa Pullover, weich und warm mit einem kleinen Herz auf den Ärmel gesickt. Natürlich.
Und dann unübersehbar das große Paket.
Alle warteten darauf, dass meine Augen leuchten würden.
Aber sie leuchteten weniger. Nicht, weil ich mich nicht freute – sondern weil die Überraschung schon vergangen war. Ich hatte sie mir selbst genommen.
Er war da. Mein Teddy. Mein größter Wunsch.
Ich hielt ihn fest. Und liebte ihn. Viele Jahre lang.
Ich war damals ein Kind. Heute bin ich erwachsen. Aber eines weiß ich aus beiden Zeiten:
Ja, in diesem einen Winter habe ich mir mein eigenes Leuchten gestohlen.
Aber ich habe es mir später, immer wieder Stückchen für Stückchen mehr, zurückgeholt.
Mit jedem Weihnachten, an dem ich nicht geschnüffelt habe.
Mit jeder Überraschung, die ich kommen ließ.
Mit jeder kleinen Aufmerksamkeit, die mich unerwartet traf.
Und manchmal, wenn ich ein Geschenk auspacke – groß oder klein – denke ich an Teddy Balu. An dieses warme, volle, kindliche
„Da bist du ja.“
Dann spüre ich:
Das Leuchten von damals ist nie verschwunden.
Es hat nur gewartet, bis ich bereit war, es wieder einzuladen.
Heute freue ich mich an Weihnachten wie damals – ehrlich, neugierig, offen. Nicht wie ein Kind, das heimlich sucht, sondern wie ein Mensch, der weiß:
Das Schönste ist nicht, etwas zu finden.
Sondern es geschenkt zu bekommen.
Mit Herz. Mit Liebe. Mit Leuchten.
„Im elften Stock. Kein Großstadtlärm. Er bleibt hinter bodentiefen Fenstern, die sich nicht öffnen lassen. Draußen reicht nur das ununterbrochene Blinken von Ampelanlagen und Autos herauf – Bewegung ohne Geräusch, Präsenz ohne Nähe.
Ich stehe im Bad eines Hotels. Weiße Fliesen, zu helles Licht. Über mir dieses dünne elektrische Summen, das man erst bemerkt, wenn man nichts tut. Der Spiegel hängt – selbst für meine Größe – zu hoch. Ich strecke mich automatisch, ziehe die Schultern zurück. Haltung, noch bevor ich darüber nachdenke.
Ich sehe ordentlich aus. Gepflegt. Die Kostümjacke ist, was sie sein soll: bügelfrei, stilvoll, klassisch modern in Schwarz. Funktionalität als Versprechen.
Lange blonde Haare, frisch, sauber. Leichtes Make-up, das meine blauen Augen betont. Genau richtig, um nicht gefragt zu werden, wie es mir geht.
Ich lege die Hände auf das Waschbecken. Das Porzellan ist kalt, die Kälte zieht in die Handballen bis in die Finger. Am Rand des Ausgusses hat sich ein einzelnes Haar verfangen – rot, gelockt.
Ich presse kurz die Lippen zusammen.
Mein Blick hält nicht. Er rutscht ab, kehrt suchend zurück.
Im Spiegel stimmt etwas nicht.
Die Haare dort sind rot. Nicht grell, aber zu präsent. Ein Rot, das Aufmerksamkeit fordert, ablenkt. Meine Brust zieht sich zusammen, dieses vertraute Gefühl kurz vor etwas, das volle Präsenz verlangt.
Die Augen im Spiegel sind größer, schwarz umrandet, dick, zu sauber. Als hätte jemand versucht, sie offen zu halten – koste es, was es wolle. Mein Nacken wird hart, die Muskeln spannen sich an, als würde ich mich innerlich wappnen.
Der Mund lächelt. Blutrot. Zu akkurat für ein Lächeln. Die Farbe wirkt dick aufgetragen, an den Rändern minimal verwischt, nicht ganz dort, wo ein Mund endet. Aufgemalt. Überzeichnet. Routiniert. Kontrolliert. Ein Lächeln, das man aufsetzt, bevor jemand etwas merkt.
Ich rieche Schminke. Süßlich, alt. Sie legt sich auf den Gaumen.
Ich schlucke.
Der Clown verbeugt sich leicht, höflich, angepasst. Das Lächeln ist nicht verschwunden, es ist nur schmaler geworden, ein Mundwinkel minimal höher, als hätte er nichts mehr zu beweisen. Danke. Danke. Danke.
Meine Schultern beginnen zu schmerzen, erst dumpf, dann deutlicher, als hätte ich dort etwas getragen, das nicht für mich war. Ich merke, dass ich die Luft anhalte, der Atem bleibt oben, flach, fest. Ich zwinge mich zu atmen, langsam, durch die Nase. Es geht stockend.
Die Tränen im Spiegel sind gemalt, symmetrisch, perfekt. Sie verlaufen nicht. Sie bleiben.
Meine Finger kribbeln, ein leichtes Brennen. Ich presse sie stärker auf das Waschbecken.
„Du bist nicht ich“, sage ich. Meine Stimme klingt flach. Zu flach für den stockenden Aufruhr in mir.
Der Clown lächelt weiter.
Dann hebt er die Hand. Nicht schnell, nicht drohend, ganz selbstverständlich, und legt sie mir auf die Schulter. Mein Körper reagiert sofort – ein kurzer Schreck, ein Zusammenziehen im Bauch. Die Schulter wird schwer, warm, als läge dort ein Gewicht. Ich spüre den Druck. Nicht fest, aber bestimmt genug, um zu sagen: Bleib.
Mein Atem stockt, der Brustkorb hebt sich nicht mehr, der Nacken zieht scharf bis in den Kopf. „Das kannst du“, sagt der Clown ruhig, freundlich. Ein Satz, den ich kenne. Den ich oft gehört habe. Den ich selbst gesagt habe.
Meine Knie werden weich, nur minimal, aber ich merke es. Ich ziehe die Schulter weg, langsam, bewusst. Der Druck verschwindet, doch die Stelle bleibt warm, als hätte jemand sie markiert. Der Clown zieht die Hand zurück, verbeugt sich erneut, ein kleines Nicken. Zustimmung.
Ich lasse die Schultern fallen, absichtlich. Es zieht im Rücken, dann ein leises Knacken im Nacken. Schmerz. Kurz. Echt. Das Rot verblasst, die Augen werden kleiner, das Lächeln verliert Spannung. Der Spiegel zeigt wieder mich. Nicht glänzend, kein Foto für ein Hochglanzmagazin. Aber da.
Ich greife nach dem Lichtschalter, meine Hand zittert leicht. Als das Licht ausgeht, atme ich aus. Lang. Unkontrolliert. Ich bleibe einen Moment stehen im Halbdunkel. Meine Schulter pocht noch.
Der Spiegel ist nur noch eine dunkle Fläche. Als hätte er Zeit.
Ich weiß nicht, ob ich noch in den Spiegel sehe oder ob er mich ansieht. Und für einen kurzen, sehr klaren Moment frage ich mich: Wenn ich jetzt gehe – wer von uns beiden bleibt dann hier stehen?
Meine beste Freundin war seit vier Wochen tot, als ich den Zettel fand, den sie mir nicht mehr gegeben hatte.
Er lag zwischen zwei Büchern in ihrer Wohnung. Kein Umschlag, kein Hinweis. Einfach ein gefaltetes, loses Blatt, einmal benutzt, dann zur Seite gelegt. An der Kante leicht eingerissen. Ihre Handschrift. Unordentlich, eilig wie immer, als hätte sie keine Geduld für saubere Linien.
„Nicht jetzt“, stand da.
Ich saß auf dem Boden, zwischen Kisten mit Dingen, die niemand mehr brauchte, und Dingen, von denen ich nicht wusste, ob ich sie behalten durfte. Die Fenster waren gekippt. Es roch nach kaltem Kaffee und nach ihrem Parfum, das sie sparsam benutzte – als würde sie es sich einteilen.
Wir hatten viel vorgehabt. Nicht diese großen, pathetischen Pläne, die man anderen erzählt. Sondern unsere.
„Irgendwann machen wir das.“
„Wenn es ruhiger wird.“
„Im Sommer, ganz bestimmt.“
Verschiebbar, dachten wir.
Wir hatten Listen. Keine ordentlichen.
Eher verstreute Sätze.
Dinge, die wir uns gegenseitig zeigen wollten. Orte, zum sitzen, stehen, bleiben.
Ich nahm das Blatt Papier mit. Steckte es in meine Jackentasche. Vergaß es dort.
Erst eine ganze Weile später fand ich es wieder. Beim Warten. Auf irgendetwas. Ich weiß nicht mehr was.
„Nicht jetzt“, stand da immer noch.
Ich begann, mir vorzustellen, dass sie mir Aufgaben hinterlassen hatte. Nicht bewusst. Nicht geplant. Eher so, wie sie Dinge immer gemacht hatte: halb gedacht, ganz gemeint.
Mallorca stand weit oben.
Santanyí. Dieses eine Café, von dem sie geschwärmt hatte, dass man dort sitzen muss. Unter Orangenbäumen. So lange, bis man vergisst, wie spät es ist.
Ein Café con leche, original, nichts Aufgesetztes. Dazu die besten frisch gebackenen Ensaimadas der Insel. Die Burg im Hintergrund, warmes Gestein, und dieser Geruch – Orangenblüten. Azahar. Süß, fast schwer.
„Das ist ein Ort, der nichts von dir will“, hatte sie gesagt. „Außer, dass du bleibst.“
Palma wollten wir bummelnd entdecken, durch kleine, enge Gassen schlendern, von Boutiquen angezogen, die uns beim Eintreten mit leise klingenden Glöckchen verführten, ohne Plan, ohne Uhr.
Und unbedingt in diese große Tropfsteinhöhle im Nordosten der Insel. „Da geht man rein und kommt anders wieder raus“, hattest du gesagt. „Das merkt man.“ „So was vergisst man nicht.“
Jetzt weiß ich nicht, ob du recht hattest oder ich es deshalb nicht geschafft habe, allein hinzugehen.
Paris war ihr Frühstückstraum.
Croissants. Viel zu buttrig. Krümel überall.
Ein dickes Eintunken in einen un bol de café au lait– wir hätten es falsch ausgesprochen „Isch weiß nickt wie sagd mann?“ und uns darüber kaputtgelacht.
Am Fenster sitzen, Menschen beobachten.
Ihre unglaublichen Styles. Ihre Haltung.
„Die sehen alle aus, als hätten sie eine Geschichte“, so höre ich sie noch.
Und wir hätten uns welche ausgedacht.
Rom stand auch auf der Liste.
Die Spanische Treppe.
Sitzen, schauen, vergleichen.
„Ist dir mal aufgefallen,
dass Männer in Italien genauso gut angezogen sind wie Frauen?“
Wir hätten genickt. Natürlich.
Frankfurt stand auf unserer Liste, obwohl wir beide wussten, dass es kein klassisches Ziel war. Der Palmengarten. Mitten im tiefsten Winter.
„Wir tun einfach so, als wären wir in der Karibik“, hatte sie bestimmt.
Es soll da einen Wasserfall geben.
Plätschern, warme Luft, große Blätter.
Wenn man die Augen schloss, war da dieses Geräusch, und die Feuchtigkeit legte sich langsam auf die Haut.
Für einen Moment sollte es sich anfühlen wie woanders.
Düsseldorf.
Der Markt am Carlsplatz.
Käse. Oliven. Brot vom Traditionsbäcker. Erdbeeren im Winter.
Picknick am Rhein. Karierte Decke.
Rosa Champagner. Immer ein Mädchen eben.
„Wer sagt eigentlich, dass man immer vernünftig sein muss?“, hatte sie gefragt.
Wir hatten sogar überlegt, uns ein Cabrio zu leihen.
Am besten gleich ein Luxusauto mit offenem Dach.
Nur für eine kleine Spritztour.
Sonnenbrille. Kopftuch. Wind um die Nase.
Einen Song aus den 80ern der aus dem Radio schallte, lauthals mitsingen. Vorbeieilende Passanten, die uns hinterherwinken.
Die Arme und Hände nach oben gestreckt.
Einfach fahren. Dieses Gefühl von Freiheit, das man nicht erklären kann.
Maastricht stand auch da.
Ein André-Rieu-Konzert.
Sie hatte gelacht, als sie das vorschlug, und so getan, als würde sie Geige spielen – Luftgeige, mit vollem Körpereinsatz.
„Versprich mir, dass wir da hingehen“, hatte sie gesagt. „Wer besorgt die Karten? Du weißt doch, die sind mindestens ein Jahr vorher ausverkauft. Eigentlich noch früher. Man muss ewig im Voraus planen. Aber wir kriegen das hin. Es ist ja quasi um die Ecke.“
Im Alter, hatten wir uns vorgestellt, verwitwet also irgendwann später, würden wir auf unserer Finca am Pool sitzen, mit Blick aufs Meer, und uns jeden Tag denselben Sonnenuntergang ansehen, ohne jemals müde davon zu werden.
Umgeben von Mandelbäumen, einer kleinen Obstplantage und Tomatenbeeten, die man gießt, wenn es nötig ist.
Wir würden es uns auf ein wenig schiefen gepolsterten Liegestühlen bequem machen, Gläser mit frisch gepresstem Orangensaft in der Hand, mit einem kleinen Schuss Campari – dir gefielen diese roten, sich langsam verändernden Schlieren im Saft – und über das Sein oder Nichtsein philosophieren.
Das letzte halbe Jahr war intensiv gewesen. Kranksein hat eine eigene Zeitrechnung. Tage dehnen sich, Nächte verlieren ihre Ordnung. Wir waren viel zusammen. Mehr als je zuvor. Nicht aus Pflicht. Aus Nähe. Still. Lachend.
Man redet weniger, aber genauer.
Ich denke daran, wie alles begann.
Wir hatten uns beim Gassigehen kennengelernt. Unsere Hunde verstanden sich sofort.
Kein Abtasten. Kein Zögern.
Und hatten uns spontan für ein Agility-Training verabredet.
„Die sollen Spaß haben“, hatte sie gesagt.
Ich hatte genickt.
Danach wollten wir einen Kaffee trinken. Irgendwo, wo Hunde willkommen sind und niemand die Stirn runzelt.
Irgendwann hatte sie mich gebeten, eine Geschichte zu schreiben.
Über beste Freundinnen.
„Aber zusammen“, hatte sie gesagt.
„Wir schreiben die zusammen.“
Jetzt schreibe ich sie allein.
Ich ging allein an Orte, an denen wir zusammen hätten stehen sollen.
Ich bestellte für zwei und aß langsam.
Ich ließ Gespräche zu, die ich früher vermieden hätte.
Ich sagte Sätze, die ich sonst geschluckt hätte.
Manchmal dachte ich: Das hätte sie jetzt kommentiert.
Manchmal dachte ich: Genau so hätte sie gelacht.
Manchmal dachte ich: Das hätten wir anders gemacht.
Hätte.
Manche Dinge habe ich gemacht.
Andere nicht.
Ich saß im Palmengarten vor dem Wasserfall.
Ich habe Erdbeeren im Winter gekauft.
Ich habe dekadent - wie eine Frau aus der High Society - rosa Champagner aus flachen Schalen getrunken.
Ich habe Croissants gegessen und gedacht: Das hätte ihr gefallen.
Trauer ist kein Zustand. Sie ist Bewegung. Mal vor, mal zurück. Oft im Kreis.
Unsere Pläne sind nicht verschwunden.
Sie haben nur den Ort gewechselt.
An einem Nachmittag setzte ich mich auf eine Bank, auf der wir einmal gesessen hatten, als sie schon müde war. Wir hatten kaum gesprochen. Es war gut so gewesen. Ich blieb lange. Ging erst, als es unangenehm wurde.
Ich fing an, Dinge weiterzuführen. Nicht weiterzuleben im Sinne von ersetzt. Sondern im Sinne von getragen.
Ihre Sätze tauchten in meinen Gesprächen auf.
Ihre Haltung schlich sich in meine Entscheidungen.
Ihre Ungeduld bewahrte mich davor, Dinge ewig aufzuschieben.
Manchmal ärgert mich das. Manchmal tröstet es mich.
Ich weiß nicht, wohin Liebe geht, wenn sie niemanden mehr erreichen kann.
Aber ich weiß, dass sie bleibt, wenn man sie nicht abstellt.
Wir hatten so viel geplant. Und doch war da nichts Unfertiges.
Nur Dinge, die jetzt anders stattfinden.
Ich habe den Zettel wieder zwischen zwei Bücher gelegt.
Nicht als Erinnerung. Als Haltung.
Nicht jetzt – heißt manchmal: später anders.
Oder: allein, aber nicht ohne.
Und manchmal heißt es einfach nur:
Geh weiter. Ich bin da. Nur nicht mehr so, wie du es gewohnt warst.
Sie lebt jetzt in mir.
In meiner Erinnerung.
In meinem Herzen.
So wie sie war.
Mit Ballerinas.
Mit Tütürock.
Wie sie das Leben lachend, ihre langen blonden Haare dabei schüttelnd,
umarmt hat.
Und manchmal –
wenn ich es zulasse –
gehe ich trotzdem los.
Mit all dem,
was wir fast noch getan
hätten.
Lyrik ist für mich ein Tagebuch ohne Datum.
Ein Herzklopfen in Buchstaben.
Ein Sich-Erinnern daran, dass wir fühlen dürfen. Dass wir echt sein dürfen.
Zerbrechlich. Wütend. Leicht. Schwer. Liebend. Alles auf einmal.
Ich schreibe, um zu verstehen.
Ich lese, um zu fühlen.
Und ich teile, um zu verbinden -
wenn Sprachlosigkeit gefangen hält,
Worte fehlen. Und sich vieles lost anfühlt.
Gerade dann finden mich Herzen:
durch Zeichen, durch Worte,
durch Begegnungen.
Sie geben mir Mut
und erinnern mich daran:
Es gibt sie –
die Herz-Zeit,
in der wieder Sinn entsteht.
Und genau davon erzählen meine Lyrikbände #Herzzeitlos I - Atemlos und
#Herzeitlos II - Atemzug
Gedichte, die atmen.
Ehrlich. Roh. Und voller Seele.
So wie das Leben selbst.
Lies mit dem Herzen.
Finde dich in den berührenden, fühlenden, achtsamen, mutigen
Zwischenräumen.
Und bleib einen Moment lang bei mir
⁃ und vor allem: bei dir.
Zwischen Noailles´ Versen über Licht, Nähe und dem Unaussprechlichen.
Zwischen Noailles´ Versen über Licht, Nähe und dem Unaussprechlichen. Sie malte die Stadt zum ersten Mal mit Neunzehn. Ohne Vorlage, ohne Plan. Nur dieser plötzliche Impuls, ein Bild in sich zu tragen, das rausmusste. Die Tür war alt und grün, leicht abgeschabt. Die Gasse eng, lichtdurchflutet. Und irgendwo im Hintergrund Wasser. Ein Flirren zwischen den Häusern, das nicht ganz greifbar war. Ein Flirren zwischen den Häusern, das sich entzog, sobald man es greifen wollte. Sie wusste nicht, wie sie die Stadt nennen sollte. Wie auch? Sie kannte sie nicht. Und doch kehrte sie immer wieder. In Träumen, in flüchtigen Skizzen, welche sie auf Servietten und Rückseiten von Rechnungen abwesend zeichnete.
Der Nachmittag roch nach heißem Asphalt und Sonne auf verschwitzter Haut. Umgeben von alten Bildern, Kaffeekannen mit Goldrand, Spitzendeckchen an denen Geschichten haften, und zerkratzten Schallplatten, streifte sie über den Flohmarkt. Lies sich treiben. Zwischen einem Schachspiel ohne König und einem Koffer voller loser Tarotkarten erweckte ein alter französischer Lyrikband ihre Aufmerksamkeit. Das vergilbte Cover, der brüchige Buchrücken. Etwas daran berührte sie. Sie schlug ihn auf. Ein Geruch, der mehr nach Pinienharz roch als nach Staub, stieg ihr in die Nase.
Mit Mitte Dreißig fand sie sie. Eine Postkarte. Eingeklemmt zwischen Rimbauds Zeilen über das Entwurzeltsein und Noailles´ Versen über Licht, Nähe und dem Unaussprechlichen. Fast übersehen. Der Rand leicht eingerissen, das Papier spröde. Doch unübersehbar: der vertraute Umriss. Die Stadt. Ihre Stadt. Die grüne Tür. Die steinernen Treppen, die Spuren von Jahrhunderten trugen. Der Turm mit einem Geländer, das seine besten Tage kannte. Und dahinter: Wasser, auf dem sich Sonnenstrahlen auf kleinen Wellen wiegen. Ihre Finger zitterten leicht, als sie sie drehte. Auf der Rückseite stand kein Absender. Keine Marke, kein Datum. Nur ein einziger Satz in verblassender Tinte: Für dich. Wenn du irgendwann wiederkommst. Es beginnt immer hier. H.
Sie lehnte die Karte an die Tiffany Lampe, welche auf ihrem Nachttisch stand. Ein Erbstück ihrer heißgeliebten Großmutter, deren Charakter und Eigenarten ebenso schillernd waren. Eine zeitlose Schönheit. In der Nacht träumte sie zum ersten Mal von der Stadt von innen. Nicht als Bild. Als Erinnerung. Am Morgen war sie noch müde vom Traum, aber wach in einer neuen Weise. Als hätte jemand eine Schublade in ihrem Innersten geöffnet, die sie längst vergessen hatte. Oder nie selbst gefüllt.
Die Bilder blieben haften. Der Wind, der zwischen zwei Häusern hindurchpfiff und ihr Haar streifte. Die warme Brise, die nach Zitrone, Salz und alten Geschichten roch. Die kleine Tasse auf dem Fenstersims eines Cafés, in das sie nie gegangen war – aber genau wusste, wo die Kuchentheke mit den stets frisch gebackenen Verlockungen stand. Sie stellte die Postkarte auf ihre Staffelei. Nicht zum Malen, sondern zum Erinnern. Dann begann sie zu suchen. Nicht bei Google, nicht in Karten oder Archiven – sie suchte im Gefühl. Im Rauschen. In Liedern, die wie aus dem Nichts in ihre Playlists gespült wurden. In Sätzen von Fremden, die so klangen, als hätten sie doppelte Bedeutung.
Und dabei wuchs in ihr ein Fernweh. Nicht nach einem Ort, sondern nach etwas, das sie zu kennen glaubte, obwohl sie es nie benennen konnte. Ein stilles Sehnen, das keine Richtung brauchte, aber einen Ruf in sich trug. Sie wusste nicht, wonach sie suchte. Vielleicht war es jedoch genau dieses Gefühl, das sie immer wieder hatte aufschauen lassen. Dieses eine, dass man nicht erklären kann. Nur fühlen. Nach und nach tauchten weitere Details auf. Ein Mann mit einem Hut, den sie zu erkennen schien. Eine rote Seidenstola, die sie einmal getragen haben musste. Der Klang von alten Glocken, nicht kirchlich, eher wie ein Schiffssignal oder wie ein Lied, das man nicht kennt, aber mitsummt.
Sie begann, die Stadt zu malen. Nicht mehr flüchtig. Nicht mehr skizzenhaft. Sie kannte jetzt die Farben: das verwaschene Ocker der Häuser, das tiefe Blau der Schatten, das fast goldene Licht am späten Nachmittag. Und dann buchte sie ein Bahnticket. Einfach so. Nicht, weil sie den Ort auf der Karte fand. Sondern weil sie spürte: „Ich werde ihn erkennen, wenn ich dort bin.“ Die Fahrt ging nach Süden. Sie hatte keinen Namen, nur eine Richtung. Eine leise Ahnung. Ihre Tasche lag auf dem Schoß, die Postkarte im Seitenfach verborgen. Ihre Hände ruhten darauf, die Finger ineinander verschränkt, als hüten sie einen Schatz, der nicht verloren gehen darf.
Landschaften zogen wie Erinnerungen an einen unscharfen Traum vorbei: Olivenhaine, schieferblaue Dächer, flatternde Wäsche auf dünnen Leinen. Manche Bilder blieben hängen. Ein gelber Vorhang, der im Wind zu winken schien. Ein Baum mit nur einer einzigen Orange. Ein Hund am Straßenrand, unbewegt wie eine Statue. Surreal, wie Dinge die nie wirklich passiert sind. Der Zug stoppte ruckartig. Eine Durchsage, verrauscht, abgehackt, in einer Sprache, die sie nur halb verstand: „… e´boulement … rails … station provisoire …“ Knisternd sprach sie von „Geröll auf den Schienen“. Weiterfahrt ungewiss.
Die Türen öffneten sich zischend, ein warmer Wind strich durch das Abteil, trug Staub und einen Hauch von Sommer mit sich. Sie stand auf, nahm ihre Tasche und trat hinaus. Der Bahnsteig war klein, beinahe verwunschen. Leer. Keine Anzeigetafel, kein Kiosk, nur eine spröde Holzbank und ein Schild, das schief hing. Der Ortsname auf dem Schild an der Decke, wo Putz sich löste, wirkte eingerostet. Aber sie spürte es sofort. Etwas in ihr wurde still. Nicht leer. Eher wie eine Saite, die aufhörte zu vibrieren, weil sie angekommen war. Kein Ziel, kein Triumph. Nur ein Innehalten. Ein Wiedersehen ohne Worte.
Sie war allein unterwegs, aber fühlte sich nicht mehr fremd. Ein Gefühl wie Déjà-vu – nur leiser. Als würden die Pflastersteine sie erkennen. Sie ging los. Die Straßen waren schmal, manche schienen eher für Gedanken gemacht als für Füße. Der Weg führte bergab, vorbei an alten Mauern mit Efeu und orange blühendem Knöterich, an Fensterläden, halb geschlossen, wie müde Lider, die in der Nachmittagssonne flimmerten. Dann sah sie ihn: den Platz mit dem Brunnen. Das Café. Der Fenstersims, die kleine Tasse mit einem angedeuteten Sprung, der etwas Altes in sich trug, das nicht zerbrochen war. Die Tür mit dem grünen Lack, abgeblättert am unteren Rand. Und die Stufen, die hinabführten – genau wie auf ihrer Postkarte.
Sie blieb stehen. Ihr Herz schlug nicht schneller, sondern klarer. Kein Zweifel, kein Staunen, nur Gewissheit. „Zurück.“ Sie fand ein kleines Zimmer oberhalb des Platzes. Die Fassade charmant verwittert. Die Besitzerin sprach kaum Englisch, aber sie lächelte, als sie bezahlte. Als sie ihr den Schlüssel gab, sagte sie in einfachem Ton: „Please, when you go … key under the little statue. Next to stairs.“ Es war ein beiläufiger Satz. Und doch wie ein Zeichen, das andeutet, als hätte sie gewusst, dass jemand wie sie irgendwann kommen würde.
Am Abend saß sie am Fenster. Die Stadt lehnte sich gegen die Dämmerung. Sie stellte die Postkarte wie einen Talisman neben sich. In der Nacht träumte sie von flirrender Hitze. Und von einem Satz, der immer wieder durch ihr Inneres glitt: „Man kann sich auch an etwas erinnern, das man vergessen musste.“
Am nächsten Tag war sie früh wach. Die Stadt lag noch im Dämmerlicht, das Blau des Morgens schwer und weich wie Samt. Sie stieg die steinernen Stufen zum Wasser hinab, den Weg, den sie schon hundertfach im Traum gegangen war. Jeder Schritt war leiser als der vorherige. Als würde die Stadt lauschen. Unten am Kai. Die gusseiserne Straßenlaterne, ein nostalgisches Relikt vergangener Zeiten, flackerte ein letztes Mal – als wolle sie die Nacht verabschieden, bevor der Morgen endgültig beginnt. Kein Mensch war zu sehen. Kein Boot. Nur das leise Glucksen der Wellen gegen die Piermauer.
Sie setzte sich. Spürte den kühlen Stein unter sich. Atmete. In sich hinein. In die Stadt hinein. Dann sah sie ihn. Oder eher: sein Abbild. Im Wasser. Nicht ihr eigenes Spiegelbild. Ein anderes Gesicht. Verwischt. Fremd. Und doch vertraut. Ein Mann – vielleicht fünfzig. Dunkles Haar, ein Schal, neben seinem rechten Auge eine Narbe, die tief erschien, aber nicht traurig. Er stand nicht vor ihr. Nur im Wasser. Sein Blick ruhte auf ihr. Nicht starr, nicht fordernd. Eher wie jemand, der lange gewartet hat, ohne zu drängen. Sie blinzelte, und das Bild löste sich in Wellen auf. Aber der Moment blieb.
Sie nahm die Postkarte aus der Jackentasche. Der Beweis, dass ihr Fernweh, das sie führte, kein Zufall war. Am Nachmittag machte sie sich auf den Weg. Ohne Ziel. Nur mit dem Gefühl, dass die Stadt ihr längst sagte, wohin. Sie ging langsam. Neugierig. Offen. Ein wenig nervös – wie vor einem Wiedersehen, von dem man nicht weiß, ob man erkannt wird. Die Gassen schienen zu atmen. Schatten tanzten an den Hauswänden, als wollten sie ihr etwas erzählen. Ein leichter Wind spielte mit einer Wimpelkette zwischen zwei Fenstern, irgendwo klirrte Glas, und ein Lachen hallte aus einem Hinterhof.
Dann kam sie in eine Straße, die heller wirkte als die anderen. Nicht vom Licht allein, eher vom Gefühl. Als würde die Zeit hier langsamer gehen. Ein kleiner Laden ohne Schild. Ein Fenster mit Spitzengardine. Ein Windstoß und ein Tuch flatterte von einem Balkon. Langsam. Wie eine Geste. Ein leiser Akkordeonklang, der durch eine offene Tür wehte. Das Pflaster unter ihren Sandalen uneben. Sie blieb stehen. Nicht weil etwas Besonderes passierte. Sondern weil alles in ihr das Gefühl hatte, dass genau hier etwas still wurde. Nicht leer. Nicht beunruhigend. Nur still – wie ein Moment, den man nicht mit Worten zerstören will.
Mitten in der Gasse. Tat keinen Schritt weiter. Nicht, weil sie zögerte – sondern weil alles in ihr plötzlich schneller wurde. Über ihr eine zerbrochene Fensterjalousie, dahinter ein alter Ventilator, der nicht mehr drehte. Und Wäsche. Weiße Hemden, eine blaue Bluse, ein ausgewaschener Pyjama. Alles hing. Zwischen Himmel und Erinnern. Die Bilder, die Gerüche, das Licht – zu viel auf einmal. Ein flüchtiger Schwindel stieg in ihr auf, nicht bedrohlich, eher wie ein Überlaufen von Gefühl. Halt suchend lehnte sie sich mit dem Rücken an eine Hauswand und spürte das grobe Mauerwerk durch das dünne Leinen ihrer Bluse.
Die Wärme des Tages hing noch in der Luft. Sie fühlte nach allem und nichts. Sie schloss die Augen. Da war dieser Geruch. Eine Mischung aus – nein nicht Brot. Sondern nach etwas Herzhaftem mit Kräutern, vielleicht Fenchel, vielleicht Thymian. Und Lavendel. Unverkennbar, etwas Lavendel und dem, was in Omas Flur in der Luft lag, wenn das Licht durch die Milchglasscheiben in die Küche fiel. Ein Hauch von Zitrone und alten Nachmittagen legte sich auf ihre Zunge. Was war das, was sie da schmeckte? Sie stellte sich die Frage, die wie ein kurzer Gedankenblitz in ihr auftauchte. Was war es? Satt harzig. Kräuter. Lavendel. Zitrone. Ein Geschmack, der sich plötzlich in ihrem Mund breitmachte. Eine Erinnerung, die sich durch den Körper ihren Weg bahnte, nicht durchs Denken, sondern übers Kosten. Nicht intensiv – eher wie ein Nachklang, den die Luft mit sich trug.
Vögel zwitscherten. Fröhlich. Erwartungsvoll. Und sie erinnerte sich: an diese frühen Morgen, wenn mit dem ersten Sonnenlicht das große Durcheinander begann. Als könnten sie es kaum erwarten, endlich wieder miteinander zu sprechen, als müssten sie alles hinausrufen, was sie in der Nacht gezwungenermaßen verschwiegen hatten. Ein aufgeregtes Miteinander, wie ein Marktplatz aus Stimmen, drängend, überlagernd, als hätte das Schweigen zu lange gedauert.
Sie öffnete die Augen. Vor ihr: das matte Schimmern der hellen Fassade auf der gegenüberliegenden Seite, feine Risse, in denen sich Licht brach. Ein Zitronenbaum im Nachbargarten, der seine Blätter wie kleine Spiegel drehte. Das Blau des Himmels war kein Postkartenblau – es war gelebter Himmel. Und doch fühlte sich alles an, als wäre es nicht das erste Mal. Ihre Wahrnehmung war bis ins Feinste geschärft, als hätte jemand den inneren Regler hochgedreht. Alles strömte ein, ungefiltert, tief. Und während sie dastand, spürte sie, wie ihr Herz schneller schlug. Eine Mischung aus Staunen „Kann das wirklich sein?“ und Gewissheit. Es war ein Rhythmus, zwischen Gestern und Jetzt. Zwischen Erinnerung und dem, was sich gerade fügte. Ein inneres Nicken.
Schließlich löste sie sich von der Wand, als hätte der Moment sich selbst beschlossen. Langsam trat sie zurück in den Tag. Nicht als Flaneurin, sondern als Teil von etwas, das sich gerade begann, zu fügen. Auf dem Weg zur Unterkunft gingen ihre Gedanken mit. Leise, aufgeregt, wie Kinder, die sich ein Geheimnis flüsternd teilen. Noch war nicht alles gesagt. Aber etwas in ihr wusste: Der Abend würde antworten.
Am Abend saß sie auf dem Platz vor dem Café. Trank etwas, das nach Anis und Mandeln schmeckte. Ein Glas auf dem Nebentisch geleert. Wind trug Gesprächsfetzen von irgendwoher. Und dann sah sie ihn. Er stand nicht weit entfernt. Lehnte an einem Geländer, als hätte er auf etwas gewartet, das sich fügt. Ihre Blicke trafen sich. Er lächelte nicht sofort. Aber da war ein Erkennen in seinen Augen, als würde er sie nicht das erste Mal sehen. Ein leichtes Nicken. Fast unsichtbar. Sie erwiderte es. Kein Wort fiel. Keine Handbewegung. Kein Schritt dazwischen. Nur der Moment. Eingehüllt in etwas Vertrautes.
Er kam näher. Langsam. Als hätte er gewusst, dass sie hier sitzen würde. Hinter ihr im Café klimpern Perlmuttschalen eines Windspiels. Gedämpft, als wäre auch hier der Lärm behutsam. Einen Schritt vor ihrem Tisch blieb er stehen. Sein Blick berührte sie, wie jemand der erkennt, was längst ihm gehört. Und in ihr war es, als würde etwas heimkommen. Nicht aus der Ferne. Sondern aus ihr selbst. Zurück durch seinen Blick. Sie hielt die Postkarte in der Hand. Er sah hin. Nur kurz, aber lange genug, um es zu verstehen. Sie spürte das raue Papier, die weiche Kante. Las gefühlt zum tausendsten Mal den Satz darauf: Für dich. Wenn du irgendwann wiederkommst. Es beginnt immer hier. Darunter ein schlichtes H.
Sie strich mit dem Daumen über die Buchstaben. Die Stadt ließ sie nie los. Weil sie selbst nie gegangen war. „Da bist du ja.“ Ruhig, fast wie zu sich. Sie lächelte. „War ich denn je weg?“
Gabriele Ela Schellinger
Epilogue
Dans le tableau de Chagall. Manche Städte schreiben sich nicht auf Landkarten. Sondern im Herzen. Nicht mit Grenzen, sondern mit Gefühlen. Es war nie nur ein Ort gewesen. Es war ein Takt, eine Frequenz, ein inneres Echo. Ein Flirren unter der Haut. Wie das Sonnenlicht, das durch geschlossene Lider fällt. Sie ging später durch die Gassen. Nicht eilig, nicht zielgerichtet. Mit einem Schritt, der wusste – der Weg war nicht neu. Nur das Verstehen. Der Himmel war inzwischen tiefblau und irgendwo am Horizont rief ein Vogel, wie zur Erinnerung, dass auch die Luft voll Erinnerungen sein kann.
Sie hatte keine Antwort gefunden. Aber das brauchte sie auch nicht. Denn es ging nie um die Lösung, sondern um das Ankommen im Ungefähren. Sie blieb stehen. An einer Ecke, wo das Licht noch warm war. Die Postkarte steckte wieder im Seitenfach ihrer Tasche. Nicht als Frage. Sondern als Zeichen. Ein Windhauch wehte Lavendel in ihre Gedanken. Und irgendwo, in einer anderen Zeit, war vielleicht gerade jemand dabei, den ersten Satz auf eine Karte zu schreiben.
Für dich.
Wenn du irgendwann wiederkommst.
Es beginnt immer hier.
„Manchmal frage ich mich, ob es einen Punkt gibt, an dem alles Sinn macht.
Ob es wirklich dieses eine Gleichgewicht gibt, das all meine Linien zusammenführt.
Oder ob ich nur auf eine Illusion zulaufe, einem Bild, das in der Ferne wie eine Fata
Morgana flimmernd verschwimmt.
Ich spüre, wie mein Leben sich immer wieder verzweigt.
Ein lose geknüpftes Netz aus Möglichkeiten und Sackgassen, aus scheuen Hoffnungen
und bohrenden Zweifeln, ein Geflecht aus Fragen, die mich manchmal halten und doch
so oft weiterdrängen.
Wo ist mein Fluchtpunkt?
Bin ich schon längst dort angekommen, ohne es zu merken?
Oder ist es nur ein ferner unbestimmter Gedanke, den ich mir einrede, damit ich nicht
stehen bleibe?
Manchmal glaube ich, dass ich selbst dieses sich spiegelnde Sammelbecken bin.
Dass all das, was ich erlebe, in mir zusammenläuft:
meine steten Ängste, meine verwegenen Träume, mein wankendes Zögern,
mein beherzter Mut.
Aber dann fühle ich wieder dieses Ziehen in mir.
Dieser ungestillte Hunger, der flüstert:
Geh weiter. Es gibt noch mehr.
Mehr als das Hier und als das Jetzt,
was du schon kennst.
Und ich frage mich:
Ist das mein Sehnsuchtsort –
dieser Wunsch nach Erfüllung,
der mich nicht loslässt?
Bin ich auf der Flucht vor,
oder auf der Suche nach mir selbst?
Ich spüre die Linien, die sich in mir kreuzen,
Tag für Tag ein neues Muster,
jede Begegnung ein unbekannter Winkel.
Manchmal fühlt sich alles so eng an,
als würde ich feststecken in meinen eigenen Fragen.
Dann ist da wieder dieser blitzende Moment,
in dem ich das Gefühl habe,
dass alles möglich ist –
dass ich nicht ankommen muss,
weil ich schon längst mittendrin bin.
Was, wenn das Zentrum nicht der Horizont ist, sondern ein Punkt in mir?
Was, wenn ich nicht weglaufe, sondern mich immer tiefer hinein bewege?
In mich, in das, was ich noch nicht kenne.
Es gibt Nächte, in denen ich alles infrage stelle:
Warum bin ich hier?
Wohin führt mich mein Weg?
Was verliere ich, wenn ich loslasse?
Was passiert, wenn ich schreie?
Und was finde ich, wenn ich still werde?
Vielleicht ist das die Achse, die alles trägt:
nicht irgendwo draußen, sondern in mir –
dort, wo ich mich selbst nicht mehr erklären muss.
Ein Ort, an dem ich alle Masken ablege.
Wo ich nicht mehr fragen muss,
sondern einfach bin.
Was, wenn es keinen Fluchtpunkt gibt –
nur verschiedene Wege, unzählige Augenblicke?
Vielleicht hat das alles nur einen Sinn:
mich selbst zu ertragen, ohne zu fliehen,
atmen, ohne zu wissen, wohin ich gehöre.
Und ich stelle mir die immer wiederkehrende
Frage:
Ist dieses Jetzt –
der Augenblick, in dem ich alles sein darf?
Weil ich nicht nur ahne, sondern ganz tief in mir spüre,
dass ich genug bin.“
„Der Asphalt zitterte vor Hitze.
Wie meine Haut.
Wie meine Kehle.
Wie das, was seit zwölf Jahren in mir liegt –
verschlossen, verkrustet, verschwiegen.
Ich stehe da.
Barfuß.
In einem zu leichten Kleid, das schwerer wird mit jedem Tropfen
Schweiß.
Der Himmel über mir schwarz –
nicht langsam, nicht drohend, sondern bereit.
Ein Gewitter steht in der Luft.
Und zwischen Allem.
Dann sehe ich sie.
Lea.
Zwei Schritte vor dem Feld.
Zwei Schritte vor meiner Stimme.
Sie trägt kein Lächeln. Nur Wind im Haar.
Und einen Blick, der fällt – zuerst auf den Boden, dann zaghaft in meine
Augen.
Nur einen Moment.
Dann weicht er zurück.
Die Luft flirrt.
Ein Windstoß greift in die Baumkronen.
Blätter wirbeln, tanzen – viel zu fröhlich für das, was kommt.
„Du bist also wirklich gekommen“, sagt Lea.
Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Ton.
Kein Vorwurf.
Kein Willkommen.
Nur ein Dazwischen.
Ich antworte nicht.
Ich wüsste nicht womit.
Meine Stimme steckt irgendwo zwischen Hals und Bauch fest.
Ein tiefer Donnerschlag.
Dumpf.
Wie mein Herz, das gegen Schuld schlägt.
Meine Hände ballen sich. Dann öffnen sie sich wieder.
Der Druck unter meinen Fingernägeln hilft, nicht zu schreien.
Nicht zu rennen.
„Ich wusste nicht, ob ich dich anschauen kann“, sage ich schließlich.
Lea senkt den Blick.
Ein Schritt näher.
Zögerlich.
Ein Fuß im Matsch, der zweite auf trockenem Staub.
Wie zwischen zwei Welten.
„Ich wusste nicht, ob ich’s ertrage, wenn du’s tust“, murmelt sie.
Die ersten Tropfen fallen.
Groß. Schwer.
Sie platschen auf die Erde, als wollten sie etwas schlagen.
Gnade gibt es keine.
Ein Blitz.
Und dann –
ein Augenblick lang: Licht auf beiden Gesichtern.
Schweiß. Tränen. Ich weiß nicht, was wozu gehört.
„Warum bist du damals gegangen, Lea?“
Meine Stimme ist rau.
Nicht laut. Aber sie zerschneidet das Schweigen wie eine Rasierklinge.
Lea schluckt.
Ihre Hände zittern.
Sie streckt sie kurz aus, als wolle sie etwas sagen. Dann lässt sie sie
wieder sinken.
Wie ein Geständnis, das zu schwer ist für Worte.
„Weil ich’s wusste“, sagt sie.
„Weil ich’s gesehen hab. Weil ich gespürt hab, was war. Und trotzdem
geschwiegen.“
Ein Rauschen geht durch das hohe Gras.
Der Himmel schlägt ein zweites Mal zu.
Laut.
Nah.
Wir zucken beide zusammen –
dieselbe Bewegung.
Dieselbe Angst.
Ein Echo von früher.
„Er hat … er hat mich angefasst!“
Ich sage es.
Endlich.
Nicht als Frage.
Als Öffnung.
Lea hebt den Blick.
Zum ersten Mal wirklich.
Ihre Augen sind leer – nicht von Gefühl, sondern von Überleben.
„Ich hab’s gesehen. Ich hab’s gewusst.
Dein Blick, wenn du von der Küche kamst.
Dein Schweigen nach dem Lachen.
Deine Hände, die immer etwas hielten, als müsstest du dich festhalten,
um nicht zu fallen.“
„Und du …“
Meine Stimme bricht.
„… hast nichts gesagt.“
Lea tritt einen Schritt näher.
Dann noch einen.
Ihre Hände zittern.
Ihre Knie auch.
Aber sie bleibt stehen. Direkt vor mir.
„Ich war sechzehn, verdammt.
Ich hatte Angst, dass du mich hasst, wenn ich’s sag.
Ich hatte Angst, dass ich Unrecht hab.
Und ich hatte noch mehr Angst, dass ich Recht habe.“
Ein weiterer Donner.
Kein Knall mehr.
Ein Brüllen.
Als würde der Himmel selbst schreien, was niemand damals sagte.
„Ich hab mich so schmutzig gefühlt, Lea.
So allein. So verkehrt.
Ich hab gedacht, ich hab’s verdient.“
Lea weint jetzt.
Offen.
Still.
Keine dramatischen Tränen –
nur Flüsse, die ihren Weg endlich finden.
„Ich hab dich im Stich gelassen“, flüstert sie.
„Ich hab mich weggeduckt.
Ich hab dich allein gelassen mit einem Sturm,
den ich hätte teilen sollen.“
Wir heben gleichzeitig die Hände –
keine Umarmung.
Aber ein Berühren der Finger.
Zitternd.
Suchend.
So, als prüften wir, ob das noch geht:
Kontakt.
Verbindung.
Wahrheit.
„Ich schreib seit Jahren über dich“, sage ich.
„In Gedichten. In halben Sätzen.
Du bist überall. Nur nicht hier.“
Lea nickt.
Dann sieht sie zum Himmel.
Der Regen hat nachgelassen.
Die Tropfen tropfen nur noch von unseren Wangen.
„Schreib über uns. Wenn du willst.
Oder … sprich mit mir.“
Wir stehen so da.
Inmitten von Pfützen, Erinnerung und Erlösung.
Keine Umarmung.
Kein Vergeben.
Aber ein Raum, in dem es wieder möglich ist, zu atmen.
Der Himmel über uns ist nicht mehr schwarz.
Aber auch nicht blau.
Ein Dazwischen.
Wie wir.
Und vielleicht ist das genug.
Für einen ersten Schritt.“
Mit 20 minütiger Verspätung fährt der Zug endlich in den Bahnsteig ein. Das Thermometer an der roten Ziegelwand im Bahnhof zeigt stolze 35 Grad. Kopfschüttelnd lache ich kurz ironisch auf, als auf der Anzeigetafel meines Gleises „ICE 375 von München - Hamburg/ Altona“ geht pünktlich auf Gleis 7“ steht.
Das ich mit dem Zug fahre, hat absoluten Seltenheitswert und ist eher die Ausnahme, als die Regel. Ehrlicherweise muss ich zugeben: Ich mag Zugfahrten nicht. Ich empfinde Züge als voll, hektisch, stickig, dreckig. „Typisch, aussen bullenheiß und die Klimaanlage hat sich auch schon in die Ferien verabschiedet. Hallo sie funktioniert nicht“ grummel ich vor mich hin, als ich meinen Koffer in das Gepäcknetz über meinen Sitzplatz hieve. Selbst mir klebt mein leichtes Tanktop unangenehm verschwitzt auf meiner Haut und meine Jeansshort kneift, als ich mich setze. Die mit billigem, abgewetzten Stoff überzogenen Sitze sehen auch nicht gerade einladend aus. „Wer in Dreigottesnamen klebt Kaugummi mitten auf die Rückenlehne, neben meinem Platz“ schüttel ich angeekelt meinen Kopf.
Als ich Platz genommen habe, blicke ich mich um. Ich teile mein Abteil mit einer jungen Frau, welche Kopfhörer trägt, aus denen leise irgendwas mit - summer in the city - dringt und sie dabei im Takt der Musik rhythmisch mit dem Kopf nickt und ihrem rechten Fuß wippt. Ihre Augen sind geschlossen. Und einer Nonne, welche mir schräg gegenüber sitzt. Ihr Anblick ist in dieser stickigen Hitze fast surreal. Sie trägt die traditionelle Kleidung, volles Ornat. Schwarzer knöchellanger Kittel, mit einem hohen steifen weißen Kragen. Dicke graue Wollstrümpfe stecken in klobigen, schwarzen Schuhen. Ihre angegrauten Haare hat sie sorgfältig unter einer hellgrauen Haube verborgen, nur mit zwei schlichten Haarnadeln festgesteckt. Ihr Gesicht ist von feinen Linien gezeichnet und um ihre ungeschminkten, grauen Augen bilden sich Lachfältchen, als sich unsere Blicke treffen und sie mir freundlich zunickt. Ein schlichtes Kreuz, welches sie an einer Kette trägt, liegt flach vor ihrer Brust. Eine große braune, abgegriffene Reisetasche, die Nähte an den Kanten sind leicht ausgefranst, hält sie mit ihren beiden runzligen Händen fest auf ihrem Schoß. Mein Blick fällt auf einen Siegelring, welcher ihren rechten Ringfinger ziert. Ich kann nicht aufhören sie anzustarren. „Wie hält sie das bloß aus, ihr muss doch schrecklich heiß sein, die muss doch kaputtgehen“, frage ich mich.
„Darf ich sie etwas fragen?“ Meine Stimme ist zögerlich, fast entschuldigend. Sie nickt und sieht mich aufmerksam an. „Ist ihnen nicht furchtbar warm?“ Zu meiner Überraschung lacht sie laut auf. Sie hat ein helles, ungewohnt für ihr Alter, junges unbeschwert klingendes Lachen. „Ach wissen sie, wenn ich gehe, dann schwingt mein Rock und bauscht sich um meine Beine auf und ein Luftzug schlüpft darunter. Und da meine Haare unter der Haube feststecken ist auch mein Nacken frei. Das ist dann schon sehr angenehm.“ Mein Blick fällt auf ihren Nacken. Dort wo die Haut hervorschaut, kringeln sich kleine verschwitzte Härchen.
Wir kommen ins Gespräch. Plaudernd erzählt sie mir mit klarer, freundlicher Stimme, dass sie auf dem Heimweg von einer Pilgerreise in Rom zurück in ihr Hospiz ist, in welchem sie lebt. Und das sie noch total erfüllt sei, von dem, was sie in Rom erlebte. Sie beschreibt die besonderen Orte, die sie besucht hat, die Menschen denen sie begegnet ist und die Momente, die ihr Herz berührten. Ein reger Austausch zwischen uns beiden entsteht und lässt die Zeit wie im Flug vergehen.
Plötzlich wie aus heiterem Himmel, öffnet sie entschlossen den Schnappverschluss ihrer braunen Tasche und kramt ein klarsichtiges Zellophantütchen hervor, worin sich mehrere silberne Anhänger - Marienbildnisse aus einfachem Blech gefertigt, befinden. „Diese hier habe ich weihen lassen“. Mit den Worten und einem sanften Lächeln überreicht sie mir spontan einen der zierlichen Anhänger. „Hier bitte, dass ist für sie, das möchte ich ihnen gerne schenken.“ „Mir?“ frage ich ungläubig. „Ja, ihnen.“ „Aber weshalb?“ Ihre Augen strahlen eine Wärme aus, die meine Frage beantwortet, noch bevor sie spricht. „Ich mag sie, und wenn es soweit ist und sie je Hoffnung brauchen, dann denken sie an mich, während sie es ansehen, berühren, vielleicht bei sich tragen.“
Ich bin - was selten genug passiert - sprachlos. Der kleine Anhänger fühlt sich in meiner Hand leichter an, als ich erwartet habe. Doch die Geste - ihre Worte, ihre Güte - trägt ein Gewicht, das ich kaum in Worte fassen kann. Seit diesem Tag trage ich den Anhänger bei mir. Er ist ein Teil einer Sammlung geworden, die für mich einen unschätzbaren Wert hat. Bestehend aus
Diese Schätze sind in ein unscheinbares, verblichenes rotes Samtsäckchen eingenäht. Und wird Tag für Tag dicht an meinem Herzen, versteckt in meinem BH getragen. Ohne dieses Säckchen, gefüllt mit Symbolen für die Liebe zu mir, Hoffnung schenkend, strahlend, fühle ich mich nicht vollständig, sogar verloren. Diese Nonne schenkte mir in Form eines silbernen, geweihten Blechanhängers, mit dem Bildnis einer Marienfigur etwas so unbeschreiblich Kostbares. Mit einem offenen Herzen, ein Stück ihrer reinen Seele, nur um mich zu beschützen. Mir, einfach so …!
Schwarz-weiß lag die Welt um sie, starr wie ein Moment, der den Atem anhält. Sie stand da, aufrecht, den Blick in die Ferne gerichtet. Der schwarze Hut, der feste Griff um den Schirm – all das wirkte wie eine Rüstung. In ihrer linken Hand hielt sie eine schwarze Aktentasche aus gegerbtem Leder, abgegriffen vom täglichen Gebrauch. Ein feiner Riss zog sich an der Unterseite entlang, genau an der Naht, die sie schon so oft hatte nähen wollen – und es immer wieder vergaß. Die Tasche wirkte, als hätte sie Geschichten zu erzählen, von langen Wegen und kleinen Fluchten. Sie gehörte zu ihr, so sehr wie der Schirm in ihrer Rechten.
Ein feiner Regen legte sich auf ihren Mantel und den Schirm. Er veränderte die Luft, eine leise Erinnerung daran, dass auch scheinbar unbewegte Momente lebendig sind. Sie spürte, wie sich in der Stille etwas regte – fast unmerklich, aber da. Hinter ihr graste eine Kuh, gleichgültig, als sei es nur ein weiterer Tag. Kein Mythos, kein Rätsel – nur das Leben, das weiterging, so schlicht wie es war.
Doch in ihr arbeitete etwas. Ein Druck in der Brust, ein Gedanke, der nicht weichen wollte. Ihre Augen wanderten von der Kuh zum grauen Horizont, als suche sie dort eine Antwort, die sich nicht zeigte. Vielleicht war es keine Angst. Vielleicht nur der Zweifel, ob sie schon bereit war, einen Schritt zu gehen. Was, wenn sie einfach stehenblieb? Wenn dieser Moment, so unbewegt er schien, doch alles veränderte? Zwischen gestern und morgen lag kein Versprechen, nur ein schmaler Grat. Und sie wusste: Es lag nicht an der Welt, sondern an ihr selbst. An dem, was sie in sich trug. Und in der schwarzen Aktentasche, die sie nicht losließ.
Ein Windstoß zerrte an ihrem Mantel, erinnerte sie daran, dass auch Stehen eine Entscheidung war. Und sie wusste: Sie würde nicht daran zerbrechen. Nicht heute.
„19 Uhr Nachrichten. Ein Beitrag zur Loveparade.
Ohne genau hinzuschauen sagt mein Vater:
„In unserer Familie gibt’s sowas nicht.“
Die Gabel in meiner Hand zittert kurz.
Ich leg sie hin, als wär das Besteck schuld.
Meine Mutter räumt ab. Schweigend.
Ich bleibe sitzen. Ganz still.
Nur das Kreuz über der Tür schaut mich an.
Später schleiche ich in den Flur.
Vierzehn Stationen hängen da.
Der Kreuzweg.
Ich geh sie ab. Langsam.
Eins. Zwei. Drei.
Jede ein Bild.
Jede ein Urteil.
Ich schlage zu.
Auf die Brust. Den Bauch. Den Oberschenkel.
Immer da, wo es niemand sieht.
Wo nur ich es spüre.
Wo es zählt.
Erster Schlag: Ich hab so gefühlt.
Zweiter: Ich hab nichts gesagt.
Dritter: Ich bin noch hier.
Vierter: Ich will nicht mehr sein.
Ich bete nicht.
Ich schlage.
Mit allem, was ich nicht sagen darf.
Mit allem, was ich bin.
Mit allem, was sie nie lieben werden.
Ich bin vierzehnmal falsch.
Und das Kreuz sieht zu.
Still.
Wie immer.“
Wenn die Kompassnadel stillsteht
„Manche Geschichten beginnen nicht mit einem Ereignis,
sondern mit einer Hoffnung.
Ella trug sie tief in sich –
eine Sehnsucht, die mit jedem Tag wuchs.
Von Anfang an liebte sie ihren Sohn.
Sie sprach mit ihm,
sang ihm ihre Lieblingslieder vor
und erfand kleine Geschichten,
in denen er der Held war.
Der Held ihres Herzens.
Oft tanzte sie mit den Händen auf dem Bauch durchs Wohnzimmer,
stellte sich vor, wie er lächelt,
wie er ihre Stimme erkennt.
Dass er ihre blauen Augen hätte,
ihr Lachen.
Ihr Temperament.
Sie konnte es kaum erwarten, ihn zu sehen,
ihn zu halten, ihm die Welt zu zeigen.
Doch während in ihr das Leben wuchs,
veränderte sich etwas um sie herum.
Ihr Mann –
der ihr noch vor Monaten sagte,
dass er sich nichts mehr wünsche als eine Familie –
wurde abwesend,
kalt.
Telefonanrufe, bei denen plötzlich aufgelegt wurde.
Ein Flüstern, wenn sie ihn am Telefon hörte.
Abende ohne Kuss.
Ohne Blick.
Und Ella spürte:
Etwas zerbrach.
Ein Misstrauen wuchs in ihr,
leise, aber stetig.
Sie fuhr nachts los,
um nicht im eigenen Schweigen zu ertrinken.
Nicht aus Kontrolle,
sondern aus Angst,
ganz allein zu sein
mit dem, was unausgesprochen zwischen ihnen lag.
Dann kam die Nacht.
Die Blutungen.
Die Panik.
Die Fahrt ins Krankenhaus.
Ein Gurt wurde um ihren Bauch gelegt.
Geräte piepten.
Steriles Licht.
Und dieser Satz:
„Es sind keine Herztöne mehr zu hören.“
Was danach kam, war ein Nebel.
Ihr Körper leer.
Ihr Blick leer.
Und doch übervoll mit Schuld.
„Ich hab dich verloren, mein Sohn.“
„Ich hab nicht genug gekämpft.“
Von da an sprach sie nicht mehr darüber.
Es gab keine Sprache für das, was sie in sich trug.
Und sie traf eine Entscheidung:
Nie wieder.
Nie wieder schwanger.
Nicht aus Angst vor Schmerz –
sondern aus Strafe.
Weil sie glaubte,
ihr Recht auf Hoffnung verwirkt zu haben.
Diese eine Chance –
verspielt.
Verloren.
Mein Papa sagte oft:
„Vertrau deinem inneren Kompass.“
Aber ihr Kompass schwieg.
Zeigte keinen Weg.
Nur ein leises Zittern.
Auch Dreißig Jahre später zündet sie immer noch eine Kerze an –
nicht an seinem Geburtstag,
den es nie gab,
sondern an dem Tag,
an dem sie wusste: Er ist da.
„Du fehlst mir.“
„Ich stelle mir vor, wie du aussiehst.“
Und vielleicht ist das
ihre Form von Mutterschaft.
Eine, die niemand sieht.
Aber die sie jeden Tag spürt.“
1.
Heute ist ein Tag wie jeder andere Tag. Morgenritual: Ferro, my best Buddy, ein 32 kg schwerer Magyar Viszla, jumpt wie jeden Morgen, wir brauchen keinen Wecker um wach zu werden, mit einem Sprung in unser Bett, schubbert sich einmal quer über die Zudecke und freut sich so, als hätte er uns monatelang nicht gesehen. „Solch eine Lebensfreude, du scheinst gut geschlafen zu haben. Guten Morgen du Spinner“ lache ich ihm leise zu und wuschle seinen Kopf. Mein Mann grummelt „bester Viszla“ und dreht sich noch für fünf Minuten auf die Seite. „Möchtest du raus?“. Ferro sprintet zur Terrassentür, während ich noch ziemlich schlaftrunken hinter ihm her trotte, um ihn in den Garten hinaus zu lassen, damit er den nächsten Baum wässern kann. „Ja, ich mach ja schon auf, warte bitte, Frauchen ist doch kein D - Zug, ich muss erst einmal aufsperren“. Mr. Ungeduld gebärdet sich wie ein Derwisch vor der noch verschlossenen Tür „hast es wohl eilig deinen Garten zu markieren, du tust so, als wärst du monatelang in einer engen Kiste eingesperrt gewesen“. Aber, wer weiß, wer sich in der Nacht unerlaubterweise in seinem Revier aufgehalten hat. Womöglich Nachbars dreistfreche Katze? Tür offen, Hund raus. Währenddessen Ferro die Obstbäume zu seinem Eigen macht, mache ich mir einen Milchkaffee, welchen ich mir heute in meiner großen Smileytasse zu Gemüte führe. Mir ist heute irgendwie nach Smiley. Heute ist ein Tag wie jeder andere Tag. In Ruhe Kaffeetrinken - „geht doch nichts über einen leckeren Cafe con leche am Morgen“ nippe ich genüsslich am ersten Schluck meines heißen Lieblingsgetränkes, um wach zu werden, Mails dabei checkend „Ey cool ‚Ibizacode‘ öffnet in einer Woche seine Pforten aus der Winterpause“ gebe ich entzückt von mir, als ich die Message in meinem Posteingang lese. Ibizacode ist einer meiner Lieblingsläden auf der Insel. Um noch munterer zu werden, nehme ich eine Dusche, welche ich abschließend immer ala Kneipp mit kalt beende. Wechselduschen sollen ja angeblich den Körper straffen, na dann, Augen zu und durch. „Brrrhhh, was tut der Mensch nicht Alles“ stöhne ich, als ich nach meinem großen Badetuch greife, um mich wieder trocken und warm zu rubbeln. Abschließend alltägliche Pflegeroutine und weiter gehts. Hundegassigehklamotten an, Ferro ins Auto packen, um zum 2 km entfernten Cala Bassa Playa zu fahren, damit Ferro unser Energiebündel, seinen ausgiebigen Gassigang erhält. Ich schmunzle, als er kaum aus dem Auto „entlassen“, ungestüm zum Strand piest, um erst über den trockenen Sand und dann durchs flache Wasser zu hetzen. „Das macht Spaß, gell“ rufe ich ihm lachend hinterher. Am Ufer entlang geht es Richtung Pinienhain. Ferro kennt den Weg, ich folge ihm, während er schnüffelnd eine Fährte nach Hunden, welche schon vor ihm hier entlangliefen, Conejos oder Lagartos die Schnauze tief am Boden - Jagdhund like, aufspürt. Schlendernd nehme ich die Umgebung in mich auf. Ich liebe es den ersten Sonnenstrahlen zuzusehen, welche auf den Wellen glitzernd tanzen. Selbst die Quallen, heute scheinen es durch die Strömung in die Bucht getrieben Hunderte zu sein, welche heute das Ufer im flachen Wasser besiedeln, stören mich nicht. „Ihr seid wunderschön und graziös, wie ihr hier rumdümpelt, aber streicheln möcht‘ ich euch trotzdem nicht“ beobachte ich sie vor mich her murmelnd. Und mache ein Foto von einer besonders schönen, eleganten Medusa. Ausser mir ist nur noch die junge Frau am Strand, welche ihren Yogakurs vorbereitet, der hier täglich stattfindet. Wir nicken uns lächelnd zu „Buenos dias, che tal?!“ Mein Weg führt hoch zu den Klippen, vorbei an dichten wilden Rosmarinbüschen, Thymiangestrüpp, hohen Kiefern, über einen mit Piniennadeln bedeckten von Steinen zerklüfteten Boden, welcher unter meinen Stiefeln knistert. Den Blick rechts auf‘s Meer und den Strand der hinter mir liegt, gerichtet. „Mmmhhh, was riecht das gut“ schnupper ich die reine Luft einatmend, welche mit einem zart blumigen Geruch verfeinert ist. Ein letzter Schritt noch und ich sehe durch dichtes Gestrüpp und typisch rotblühenden Oleandersträuchern eine unendliche Weite vor mir. Blau, soweit mein Auge reicht, stahlblauer Himmel, tiefblaues Meer, entfernt streiten sich Möwen um einen Fisch. Solch ein Licht… Hier steh ich nun am Rand der Klippen, eine große, blonde Frau, von ihren Gefühlen übermannt, deren Haare vom Wind zerzaust werden. Mit Wissen ohne Zeit und Raum. Eine Erinnerung, wo auch immer sie gerade herkommt, flutet wie Brandung über die Klippen, heran. „Weshalb denke ich gerade hier und jetzt an das lindgrüne Zimmer?“ Ich beantworte mir meine eigene Frage selbst. „Ich weiß es. Es ist die Sonne. Es ist das Licht. Es ist der Wunsch nach Blau“. Schon immer gewesen. Im hier und jetzt.“
2.
Im Zimmer. Im Zimmer flackert die Leuchtstoffröhre an der Decke. „Wer hat dieses unsäglich grelle Licht angelassen?“ Meine Augen brennen. Ich habe keine Kraft mehr. „Was wäre so schlimm, wenn ich gehe, auch gehe“? „Wenn ich sterbe, auch sterbe?“ Mein Körper ist krank, mein Geist ist wach. Mir geht es gar nicht gut. Die dritte Infusion für heute, tropft unablässig aus einem milchigtrüben Plastikbehälter und rinnt klar, gleichmäßig, unablässig in einem dünnen Schlauch, durch die Nadel in die Vene meines linken Armes. Meine Arme sind dünn, fleischlos, unmuskulös, pergamentartige Haut über Knochen. Die Venen sind wie dunkle Schnüre sichtbar. Ich habe mir immer gewünscht, rank und schlank zu sein. Jetzt ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. „Man sollte sich immer zweimal überlegen, was man sich wünscht, oder seine Wünsche Wort für Wort detailliert formulieren“ sinniere ich meinen Arm betrachtend. Ich traue mich nicht den Arm zu bewegen, geschweige denn ihn anzuwinkeln. Zu groß ist die Angst, dass die Nadel abbricht. Ich mag keine weiteren „Baustellen“. Jetzt lieg ich hier in diesem Zimmer, alleine, zum Glück. Ich mag keine fremden Menschen um mich. Keine „auch kranke Menschen“ um mich. Kranke Menschen haben immer das Bedürfnis über ihre Krankheiten zu lamentieren und sich teilweise sogar noch zu überbieten. „Was, du hast XY? Das hab ich auch, aber ich hab auch noch Z und A und K dazu“… Gruselig. Als ob es nicht schon schlimm genug ist, krank zu sein. Die Wände sind lindgrün gestrichen - hässlich. Warum nicht in einem schönen Blauton. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Oder bunt. Bunt wie das Leben, welches doch noch mit meinen gerade einmal 28 Jahren vor mir liegen soll. In der oberen linken Ecke, über dem zweiflügeligen Fenster, welche sich nicht öffnen lässt, nur kippen. „Selbst das Fenster verhindert eine Flucht“, erscheint ein vorbeihuschender Gedanke, müsste mal wieder gestrichen werden. In dieser oberen linken Ecke bröckelt der Putz ab. Eine kleine Spinne liegt auf der Lauer. Nur ich kann sie von der Stelle meines Bettes, in welchem ich liege, sehen. Ich bin so müde. Mama war heute wie jeden Tag hier. Oder war es gestern? Sie weint viel. Und betet, obwohl sie doch nie so gläubig war. Ich habe in diesem lindgrünen Zimmer jegliches Zeitgefühl verloren. Ich blicke unbeeindruckt auf das Kreuz, welches über der Tür hängt. Mir ist heiß. Es ist dunkel draußen, erkenne ich durch das zweiflügelige, nun fest verschlossene Fenster. „Muss wohl eingeschlafen sein“ gähne ich, ohne die Hand vor den Mund zu halten, was Papa als echte Unart ansah. Der Infusionsständer steht wie ein stummer Diener neben meinem Bett. Ohne milchigtrüber Infusionsflasche. Nur die Nadel, mit einem weißen Pflaster fixiert, steckt noch in meinem Arm. Der Ärmel meines Herzerlpyjamas - ich habe ein Faible für Herzen - ist nach oben gekrempelt. Er ist das einzig fröhliche in diesem Zimmer. Ich schließe meine Augen. Ich bin erschöpft von meinem täglichen Kampf, gegen diese hinterhältige Krankheit. Dabei will ich doch gar nicht mehr kämpfen. Für mich jedenfalls nicht. Für Mama, meine Familie und Freunde, ja. Darf nicht gehen. Man lässt mich nicht gehen. Darf nicht sterben. Man lässt mich nicht sterben. Nicht nachdem, was mit Papa geschah. Papa ist seit zehn Jahren tot. Ich bin so müde. Die Medikamente tragen ihre Mitschuld. Bin ich wach oder träume ich? „Papa“, meine Augen füllen sich mit Tränen, meine Nasenwurzel brennt. „Papa, da bist du ja“. Papa steht in der Tür unter dem Kreuz. Und breitet seine Arme aus. Wie Jesus, auf dem Bild, als er das letzte Abendmahl verkündet. Oder wie der Pater aus unserer Kirche, bevor er am Altar die Hostie über dem Wein bricht. „Papa“ atme ich leise. „Alles wird gut“, „Alles wird gut“ flüstert es mit der sonoren Stimme meines Vaters in meinem Kopf „Alles wird gut“! „Papa, bleib, Papa …! „Alles wird gut“. Am nächsten Morgen wache ich auf „Hi, Trudi, wie war deine Nacht“ lächle ich meiner Zimmergenossin zu, welche unterdessen ein kunstvolles Netz in der oberen linken Ecke des hässlich lindgrünen Zimmers gesponnen hat. Die Sonne sucht sich einen Weg durch die halbzugezogenen Vorhänge. Es wird Licht. Und ich fühle mich gut.
3.
Nun steh ich hier oben, um mich herum Blau. Spüre die Wärme der Sonne auf meinem Gesicht. Atme tief ein und plötzlich treten mir Tränen in die Augen, nicht vor Traurigkeit, sondern vor purem reinem Glück. Hier auf den Klippen, mit dem Blick auf die Welt, die vor meinen Füssen liegt. Mein Herz öffnet sich für die innere Ruhe, welche mich erfasst, erfüllt von tiefem Frieden. Mein Herz ist so dankbar, hier sein zu dürfen. Ich weine, lächle und halte diesen Augenblick für immer tief in mir fest. „Namaste“. Gib niemals auf. Das Leben ist schön. 32 Jahre später … ich bin immer noch hier. Heute ist ein Tag wie jeder andere.
Als ich Peter das allererste Mal sah, dekorierte er hinter einer großen Schaufensterscheibe eines bekannten Warenhauses, einen Esstisch aus Holz mit kunterbuntem Essgeschirr, und dachte noch so beiläufig „Hhmm wie scheußlich, das passt ja so gar nicht zusammen“, aber über Geschmäcker kann man ja seit Urzeiten streiten. Ich stand nur da - und hoffe heute noch inständig, dass mein Mund geschlossen war: baff, perplex, hin und weg. Mein Traummann! Etwa 185 groß, hellbraun gewellte Haare, welche süß zerstrubbelt auf einer Seite hochstanden, cool mit Levis Jeans und T-Shirt ala James Dean. Und mit den tollsten Händen, welche ich je gesehen habe: stark, kräftig und doch mit so sensiblen Klavierspielerfingern, welche in dem Moment das bunte, leicht zerbrechliche Porzellan vorsichtig drapierten. Was um ihn herum, ausserhalb des Schaufensters passierte, nahm er nicht wahr.
WER IN DREIGOTTESNAMEN IST DAS?
Ich wusste, so wahr ich hier sitze und schreibe: ich musste unbedingt seine Aufmerksamkeit gewinnen. Oder ich würde mein Leben lang in unerfüllter Neugier dahindarben. In Heilig-Drei-König und heiliger Strohsack – wo kam dieser Wunsch diesen Typen mit den schönsten Händen der Welt unbedingt kennenlernen zu wollen, denn bitte plötzlich her?! Als hätte mir Amor höchstpersönlich einen Pfeil in den Hintern geschossen. Und nicht zaghaft. Nein – zielsicher. Mit Anlauf.
Wollte ich etwa gleich Kinder mit ihm kriegen? Na, ganz bestimmt nicht. Ich war sechzehn, nicht bescheuert. Oder lag’s daran, dass ich einfach mal selbst entscheiden wollte, wer mein Freund sein sollte – nicht der Typ aus der Parallelklasse, der ständig „Grüß Gott“ sagte, als wär er fünfzig, nicht der Schwarm meiner Freundin, den sie doch eh nie ansprach, und ganz sicher nicht der, den Mama mit einem „Der kommt aus einer guten Familie, der ist doch nett“ vorschlug. Ich wollte keinen, der auf dem Papier passte. Ich wollte ihn. Vielleicht, weil er so ganz anders war. Vielleicht, weil ich bei seinem Anblick das Gefühl hatte, dass ich plötzlich anders sein könnte – mutiger, entschlossener, verrückter. Oder vielleicht wollte ich einfach nur wissen, wie es sich anfühlt, nicht nur von einem Typen zu träumen, sondern ihn sich selbst auszusuchen. Was auch immer es war – ich wusste nur: Ich muss etwas gegen diese akut auftretenden Wackelpuddingknie machen. Ein Plan musste her.
Glücklicherweise lebte ich in einem Seelendorf mit 40.000 Leuten ganz oben in Bayern, wo jeder jeden kennt – ob man will oder nicht. Claudia eine gute Freundin, Berufsstand Verkäuferin in der Damenoberbekleidung eben dieses Warenhauses, wusste mit Sicherheit, wer ER ist. Ich, kurzentschlossen rein in den Laden, die Rolltreppe hochsprintend in die erste Etage, Abteilung DOB um nach Claudia Ausschau zu halten. Weit und breit jedoch keine Claudia. „Arbeitet Claudia heute nicht oder hat sie gerade Pause?“ „Claudia hat seit heute eine Woche Urlaub.“ Diese Info, war das Letzte, was ich von Claudias älteren Kollegin, welche hinter der Kasse stand, hören wollte. Wie sollte ich eine Woche durchstehen, um an die wichtigste Information meiner gerade 16 gewordenen jungen Jahre zu kommen? Das steh ich niemals durch. Die Kassiererin nach diesem 5 Sterne Typ im Schaufenster zu fragen, traute ich mich allerdings auch nicht. Warum kann nicht einmal in meinem Leben Etwas sofort klappen. Eine ganze Woche unwissend bleiben … oder ganz schlimm, ich sitz noch mit 80 da und frag mich, wer dieser Typ im Schaufenster war. Welch gruselige Vorstellung. Ein neuer Plan musste her.
Im Stadtbus, auf dem Weg nach Hause ging ich alle Bekannten, Klassenkameraden und Freunde in meinem blonden Wuschelkopf durch „wer könnte IHN kennen?“ Zeitverschwendung war noch nie mein Ding.
„Na, wie war‘s in der Schule, hast du Hunger, hast du Hausaufgaben auf, stell bitte deine Schuhe auf den Läufer und wasch dir die Hände bevor du dich an den Tisch setzt.“ „Mama, ein Brot reicht mir, ich muss mich auch gleich an diese Physikübungen machen, wir schreiben morgen bestimmt eine Ex, einen unangekündigten Test, die Höfer ist doch immer so ultrapingelig, ich geh gleich auf mein Zimmer und lerne.“ „Du setzt dich jetzt ordentlich an den Tisch und isst vernünftig, mit etwas Gutem im Magen lernt es sich noch viel besser.“ Wenn die wüsste, was ich eigentlich vorhabe, würde sie mich am Esstisch Physik büffeln lassen. Mit meinen Gedanken bei einem lässigen Hünen, nahm mein neuer Plan so ganz langsam Formen an, während ich das vorgesetzte Wiener Schnitzel kaute und den Kartoffelsalat gedankenverloren in mich hinein schaufelte.
Am nächsten Morgen, und einer überraschend gut durchschlafenen Nacht auf dem Weg zur Schule, erzählte ich meiner aller-allerbesten Freundin Petra – mit der ich schon seit der ersten Klasse befreundet war und mit der ich unsere tiefsten Geheimnisse seit Urzeiten teilte, die ja noch gar nichts von IHM wusste – ALLES!!
Petra, immer sehr pragmatisch und direkt, meinte sofort „sprech’ ihn doch einfach an und frag ihn, wie er heißt … .“ Genau, ich geh hin, klopf an die Scheibe und frag ganz cool „wie heißt`n du?“ Gehts noch blöder. Wobei mein Plan schon so ein wenig, in diese Richtung tendierte. Erst einmal ein wenig beobachten. Und Blickkontakt suchen. Und dann lächeln. Und dann „hy“ sagen, … wenn er reagiert.
Aber mal ehrlich – wie hätte er mich nicht bemerken sollen? 178 cm geballte Teenie-Hoffnung, weizenblonde Mähne im Wind, eine halbwegs anständige Figur (danke, Turnunterricht) – und das Ganze verpackt in eine enge Bluejeans und einen hellblauen Pulli, der zufällig genau meine Augenfarbe traf. Also bitte. Wobei … ehrlich gesagt war ich mir selbst nicht ganz sicher, ob ich gerade wahnsinnig cool oder einfach nur komplett überdreht wirkte. Aber hey – auffallen ist auffallen, oder?
Direkt nach der Schule, ging ich mit Petra im Schlepptau schnurstracks zum Ort des Geschehens. Und da war er wieder, der Mann meiner bis dato unerfüllten Träume. Diesmal im Nachbarfenster um hochkonzentriert einer Schaufensterpuppe die Blöße zu nehmen, und sie mit einem blassgelben Kleid anzuziehen. Petra kicherte kindisch und flüsterte hinter vorgehaltener Hand „von dem würd’ ich mich lieber ausziehen, als anziehen lassen.“ Und hob doch tatsächlich ihre Hand um ihm zuzuwinken. Die doofe Kuh, sie steht doch sonst eher auf dunkelhaarige Typen, wie Guiseppe den Sohn unseres italienischen Eisdielenbesitzers, flammte es kurz eifersüchtig in meinen Gedanke auf. „Geht’s noch auffälliger?“ und schubste sie in die rechte Ecke hinter dem Fenster, wo ER uns nicht sehen konnte. „Ich dachte du wolltest ihn kennenlernen?!“ Na, aber doch nicht so! Ich merkte schon, mit Petra zusammen, das wird so nichts. Wie kann man sich nur sooo unreif benehmen. Erst einmal in die Eisdiele die Straße hoch, um sich bei einem „Stampf - Schokoeis, mit Schokostreusel und Schokosauce“ Mut zufüttern. (Um meine Figur habe ich mir erst 30 Jahre später Gedanken gemacht.) Und um Petra, mit Guiseppes Anblick und seinen typisch italienischen Komplimenten „Cara, mia bellezza“ von IHM abzulenken.
„Und jetzt?“, fragte ich mich zwischen zwei Schokostreuseln. Noch sechs Tage auf Claudias Rückkehr warten? Im Ernst?! Oder doch allein noch mal losziehen, vor dem Schaufenster auf und ab flanieren – ganz so, als würde mich das kunterbunte Geschirr brennend interessieren? Haha. Total unauffällig natürlich. In meinem Kopf tobte der übliche Zirkus: Ich will wissen, wie er heißt. Wo er wohnt. Ob er Pizza mag. Was er mag. Ob er vielleicht auch nachts wachliegt und denkt: Wer war diese junge Frau mit dem Pulli in Augenfarbe? Aber dann wieder: Der bemerkt mich doch eh nicht. Warum auch. Hin- und hergerissen zwischen Mut und Mimimi, schaufelte ich mein Eis in mich rein – Stampf-Schoko mit allem, was drauf und drin war – und versuchte, nicht komplett durchzudrehen. Egal!
Gedacht, gesagt, getan. Was sollte schon passieren? Außer, dass ich mich komplett zum Volldeppen mache, vielleicht über meine eigenen Füße stolpere – oder im schlimmsten Fall frontal gegen die Schaufensterscheibe knall, weil ich natürlich ganz zufällig dieses blassgelbe Kleid aus nächster Nähe bewundern will. Ja klar. Total unauffällig. Ich – das neugierige Deko-Girl mit dem Charme einer Flipperkugel.
Ohne noch eine weitere Sekunde meines Lebens zu zögern, stand ich plötzlich auf, sagte zu Petra, welche eh mit Guiseppe flirtete, ich komm gleich wieder, zahlst du bitte schon mal für mich mit, schnappte mir meine Schultasche und machte mich auf den Weg zu IHM.
200 m, ohne nach rechts oder links zu blicken, die Augen nach unten, zügig ausschreitend. Bis ich volle Kanone ungebremst in den Rücken von Jemanden hineinkrache und abrupt mitten im Lauf gestoppt werde. Ausgerechnet in Jemanden der vor dem Schaufenster steht, um dessen Dekoration zu begutachten.
Ohne noch eine weitere Sekunde meines Lebens zu zögern, stand ich plötzlich auf. „Ich komm gleich wieder. Zahlst du bitte schon mal für mich mit?“, sagte ich zu Petra – die sowieso gerade mit Giuseppe flirtete. Schnappte mir meine Schultasche – und los. 200 Meter, ohne nach rechts oder links zu blicken. Zügig ausschreitend. Die Augen nach unten. Bloß nicht nachdenken. Bis ich volle Kanne und völlig ungebremst in jemanden hineinknalle. Mitten im Lauf. Ausgerechnet in jemanden, der direkt vor dem Schaufenster steht – und offenbar die Dekoration begutachtet, als hätte er nichts Besseres zu tun, als genau dort zu stehen, wo sich mein Schicksal entscheiden sollte.
„Hopperla, nicht so schnell.“ Erschrocken schaue ich auf starke, kräftige Hände mit Klavierspielerfingern, die mich vorm Hinfallen auffangen und festhalten. Dann blicke ich nach oben und lande direkt in den schönsten, lachend braunen Augen, die ich je gesehen habe. „Hi, ich bin Peter, Peter Schmidt – Schmidt mit „dt“!“
NAMASTE - Buddhaliebe
Schon als ich dich das erste Mal in dem ibizenkischen Laden an der Hauptstraße Richtung Santa Eulalia in einer Ecke versteckt, zwischen Plüsch und Plunder gesehen habe, hatte ich die klare Gewissheit, dass du bei mir ein zuhause findest.
Ich kann gar nicht einmal sagen, was mich zuerst berührte: War es deine Schlichtheit? Das Einfache, was eine Seite in mir zum Klingen brachte? Eine Seelenregung welche mir unter die Haut ging?
Wenn ich dich jetzt so ansehe, dir gegenüber sitze,
gibst du mir ein Gefühl von Frieden.
Dieser in sich gekehrte und bei sich ruhende Blick.
Die Augen geschlossen, dein Mund lächelt sanft.
Du bist auch ohne Haare wunderschön.
Du sitzt im Schneidersitz auf einem Kissen, welches wie dein schlichter Umhang in lose Falten gelegt, cremeweiß, zart marmoriert glasiert ist.
Eine Gebetskette, welche in Blütenornamenten getöpfert ist, hängt als einziger Schmuck um deinen Hals.
In deinen beiden nach oben geöffneten Händen, hältst du vorsichtig ein Glas, in dem sich ein flackerndes Teelicht, welches einen sanften Schimmer auf dein Antlitz zaubert, befindet.
Immer, wenn es mir nicht gut geht und ich mentale Unterstützung brauche, zünde ich es an. Spreche ein kleines Gebet und werde umgehend tief in mir, so mitten innen drin in mir, ruhiger.
„Alles wird gut“.
Gestern habe ich dir eine Muschel vom Strand als Geschenk mitgebracht, welche ich dir als Gabe vor deine nackten Füße legte.
Schön, dass du mich gefunden hast.
„Namaste“ mein kleiner Buddha.
Das Venn. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Genauer gesagt den 14.11.2020
Ein Tag, welchen ich nie vergessen werde. Und dabei fing der Tag ganz unbeschwert und vorfreudig an.
„Ferro“ … „Ferro“ … „Ferrroooo“. Wo ist er jetzt wieder abgeblieben? Vielleicht hätte ich meinen Selbstaufklärer, #mybestbuddy, seines Zeichens ein knapp zwei Jahre junger, 28 kg schwerer Magyar Viszla (für die, die es nicht wissen: ein Ungarischer Jagdhund) - lebensbejahend, wild, verrückt, liebenswert und einer der unabhängigsten Hunde -, welche ich je kennengelernt habe -, doch nicht von der Leine lassen sollen, schießt es mir durch den Kopf. Fremde Umgebung, freie Wildbahn und im belgischen Venn mit den Sümpfen und Mooren, auch nicht ganz ungefährlich. „Ferroo“ rufe ich energisch und nicht mehr ganz so freundlich.
Es sollte doch nur eine kleine Gassirunde werden, bevor wir von der Besichtigung eines Ferienhauses, welches wir in Erwägung ziehen zu kaufen, wieder nach Hause fahren.
„Hoffentlich ist der blöde Köter nicht hinter einem Reh, oder Hasen hinterher…“ überlege ich vor mich hinbrummelnd, während ich die Gegend mit meinen Augen absuche. Der kommt schon, Ferro ist zwar einerseits ein Freigeist, jedoch andererseits ein ausgebildeter Jagdhund, welcher auf‘s Wort hört und wie ein Glöckchen pariert, versichert mir mein Wissen.
Ausgerechnet heute, muss er seine Unabhängigkeit unter Beweis stellen.
Aber weit und breit kein Hund in Sicht. Meinen Hund rufend, stampfe ich mit meinen Gummistiefeln durch hohes Wollgras und an dichten Ginsterbüschen vorbei, immer tiefer ins Venn. Langsam wird es mir trotz dicker Babourjacke und Mütze auf dem Kopf echt kalt. Hab ich schon erwähnt, das ich November hasse?! Ich hasse November! Dämmerig wird es auch schon. „Na super …“
„Warum hab ich dumme Nuss auch noch die Hundepfeife - auf welche er trainiert ist -, im Auto liegen lassen“ schimpfe ich, Selbstgespräche mit mir führend, „da hört er wenigstens drauf!“ „Ferro, verdammt noch mal“!
Plötzlich, höre ich rechts vor mir, ein platschendes Geräusch. „Ferro?“. Laute, welche ich noch nie gehört habe. Hoch. Fiepend. Slürpend.
Mein Handy als Taschenlampe verwendend, leuchte ich die Umgebung ab.
„Ferro“ schreie ich auf, als ich meinen Hund, nur noch mit dem Kopf aus einem Graben herausragen sehe, der in dem verzweifelten Versuch sich daraus zu befreien, sich dabei immer tiefer in ein Moorloch einarbeitet. Mir treten Tränen in die Augen, als ich meinen Buddy, meinen Hund in seiner schier aussichtslosen Lage erblicke.
„Ferro“, schluchze ich auf. „Alles gut“, rufe ich ihm beschwichtigend zu, „Alles gut“, während ich auf ihn zu stolpere. „Alles gut, nicht bewegen“. Panisch versucht seine linke Pfote Halt zu finden um sich selbst aus dem Sumpf, welcher ihn immer tiefer einsaugt, zu befreien. Seine rechte Pfote ist nicht mehr sichtbar, im Schlamm versunken.
Vorsichtig, der Gefahr auch für mich bewusst werdend, unablässig mit ruhiger zitternder Stimme, mit meinem Hund sprechend, lege ich mein Handy mit dem Licht auf Ferro zeigend auf den Boden. „Jetzt ja keinen falschen Schritt machen“, „nur noch knapp vier Meter“. „Alles gut, alles gut Wauz, Frauchen ist gleich da“. Meine Gedanken rasen. Ohne nachzudenken, lege ich mich flach auf den nassen, schlammigen Boden und robbe vorsichtig den letzen Meter zu ihm.
Mein Hund sieht mich mit weit aufgerissenen Augen an. Ich taste den Boden nach etwas Festem ab und ergreife ein größeres halb verwittertes Stück Holz „hoffentlich hält es mein Gewicht“ flehe ich, während ich es unter mich ziehe und stütze meine Knie darauf ab. Stemme mich vorsichtig hoch und steige mit einem Bein über den Graben, packe Ferro an seinem Halsband und ziehe. Und, nichts passiert. „Ferro, bitte bitte nicht bewegen, Frauchen ist da. Wir schaffen das gemeinsam, bitte … bitte“.
Schlamm spritzt. Und da ist es wieder, dieses grässliche, schlürfend, saugende Geräusch.
Eben noch hat Ferro gezappelt, als er von einer Sekunde auf die andere ganz ruhig wird. Angst, welche mich umklammert, pumpt Adrenalin durch meinen Körper.
Meine Beine fest gegen den Boden stemmend, mit all meiner ganzen Kraft, gegen die Sogwirkung ankämpfend, mit dem unbändigen Willen, meinen Buddy, meinen besten Freund damit zu retten, hänge ich mich mit meinem gesamten Körpergewicht nach hinten. Zerre weiter an seinem Halsband und versuche mit all meiner Kraft ihn aus diesem scheiss stinkenden Morastloch zu befördern. „Verdammt nochmal“, fluche ich mich selbst motivierend „komm schon“ „Bitte lieber Gott, hilf mir…bitte“!
Jetzt seh ich beide Vorderläufe, seine Schultern, jetzt seinen Rücken, „Ferro, gleich haben wir es geschafft, nur noch der Poppers“, keuche ich weinend. Mit einem letzten Kraftakt, zusätzlich das Fell hinter seinen Ohren packend, gelingt es mir, mich zur Seite werfend, meinen Wauz nicht loslassend, Ferro zu befreien.
Hier liegen wir nun, beide zitternd vor Anstrengung und Angst. Ferro mit Frauchen, zwei schwarze, schmutzige, stinkende Seelen. Alle Energie in diesem Moor lassend, völlig erschöpft, halte ich meinen Freund eng, ganz fest umschlungen, weine und lache gleichzeitig. „Danke“ flüstere ich „Danke“!
Das Venn. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Genauer gesagt den 14.11.2020
Ein Tag, welchen ich nie vergessen werde. Und dabei fing der Tag ganz unbeschwert und vorfreudig an.
„Ferro“ … „Ferro“ … „Ferrroooo“. Wo ist er jetzt wieder abgeblieben? Vielleicht hätte ich meinen Selbstaufklärer, #mybestbuddy, seines Zeichens ein knapp zwei Jahre junger, 28 kg schwerer Magyar Viszla (für die, die es nicht wissen: ein Ungarischer Jagdhund) - lebensbejahend, wild, verrückt, liebenswert und einer der unabhängigsten Hunde -, welche ich je kennengelernt habe -, doch nicht von der Leine lassen sollen, schießt es mir durch den Kopf. Fremde Umgebung, freie Wildbahn und im belgischen Venn mit den Sümpfen und Mooren, auch nicht ganz ungefährlich. „Ferroo“ rufe ich energisch und nicht mehr ganz so freundlich.
Es sollte doch nur eine kleine Gassirunde werden, bevor wir von der Besichtigung eines Ferienhauses, welches wir in Erwägung ziehen zu kaufen, wieder nach Hause fahren.
„Hoffentlich ist der blöde Köter nicht hinter einem Reh, oder Hasen hinterher…“ überlege ich vor mich hinbrummelnd, während ich die Gegend mit meinen Augen absuche. Der kommt schon, Ferro ist zwar einerseits ein Freigeist, jedoch andererseits ein ausgebildeter Jagdhund, welcher auf‘s Wort hört und wie ein Glöckchen pariert, versichert mir mein Wissen.
Ausgerechnet heute, muss er seine Unabhängigkeit unter Beweis stellen.
Aber weit und breit kein Hund in Sicht. Meinen Hund rufend, stampfe ich mit meinen Gummistiefeln durch hohes Wollgras und an dichten Ginsterbüschen vorbei, immer tiefer ins Venn. Langsam wird es mir trotz dicker Babourjacke und Mütze auf dem Kopf echt kalt. Hab ich schon erwähnt, das ich November hasse?! Ich hasse November! Dämmerig wird es auch schon. „Na super …“
„Warum hab ich dumme Nuss auch noch die Hundepfeife - auf welche er trainiert ist -, im Auto liegen lassen“ schimpfe ich, Selbstgespräche mit mir führend, „da hört er wenigstens drauf!“ „Ferro, verdammt noch mal“!
Plötzlich, höre ich rechts vor mir, ein platschendes Geräusch. „Ferro?“. Laute, welche ich noch nie gehört habe. Hoch. Fiepend. Slürpend.
Mein Handy als Taschenlampe verwendend, leuchte ich die Umgebung ab.
„Ferro“ schreie ich auf, als ich meinen Hund, nur noch mit dem Kopf aus einem Graben herausragen sehe, der in dem verzweifelten Versuch sich daraus zu befreien, sich dabei immer tiefer in ein Moorloch einarbeitet. Mir treten Tränen in die Augen, als ich meinen Buddy, meinen Hund in seiner schier aussichtslosen Lage erblicke.
„Ferro“, schluchze ich auf. „Alles gut“, rufe ich ihm beschwichtigend zu, „Alles gut“, während ich auf ihn zu stolpere. „Alles gut, nicht bewegen“. Panisch versucht seine linke Pfote Halt zu finden um sich selbst aus dem Sumpf, welcher ihn immer tiefer einsaugt, zu befreien. Seine rechte Pfote ist nicht mehr sichtbar, im Schlamm versunken.
Vorsichtig, der Gefahr auch für mich bewusst werdend, unablässig mit ruhiger zitternder Stimme, mit meinem Hund sprechend, lege ich mein Handy mit dem Licht auf Ferro zeigend auf den Boden. „Jetzt ja keinen falschen Schritt machen“, „nur noch knapp vier Meter“. „Alles gut, alles gut Wauz, Frauchen ist gleich da“. Meine Gedanken rasen. Ohne nachzudenken, lege ich mich flach auf den nassen, schlammigen Boden und robbe vorsichtig den letzen Meter zu ihm.
Mein Hund sieht mich mit weit aufgerissenen Augen an. Ich taste den Boden nach etwas Festem ab und ergreife ein größeres halb verwittertes Stück Holz „hoffentlich hält es mein Gewicht“ flehe ich, während ich es unter mich ziehe und stütze meine Knie darauf ab. Stemme mich vorsichtig hoch und steige mit einem Bein über den Graben, packe Ferro an seinem Halsband und ziehe. Und, nichts passiert. „Ferro, bitte bitte nicht bewegen, Frauchen ist da. Wir schaffen das gemeinsam, bitte … bitte“.
Schlamm spritzt. Und da ist es wieder, dieses grässliche, schlürfend, saugende Geräusch.
Eben noch hat Ferro gezappelt, als er von einer Sekunde auf die andere ganz ruhig wird. Angst, welche mich umklammert, pumpt Adrenalin durch meinen Körper.
Meine Beine fest gegen den Boden stemmend, mit all meiner ganzen Kraft, gegen die Sogwirkung ankämpfend, mit dem unbändigen Willen, meinen Buddy, meinen besten Freund damit zu retten, hänge ich mich mit meinem gesamten Körpergewicht nach hinten. Zerre weiter an seinem Halsband und versuche mit all meiner Kraft ihn aus diesem scheiss stinkenden Morastloch zu befördern. „Verdammt nochmal“, fluche ich mich selbst motivierend „komm schon“ „Bitte lieber Gott, hilf mir…bitte“!
Jetzt seh ich beide Vorderläufe, seine Schultern, jetzt seinen Rücken, „Ferro, gleich haben wir es geschafft, nur noch der Poppers“, keuche ich weinend. Mit einem letzten Kraftakt, zusätzlich das Fell hinter seinen Ohren packend, gelingt es mir, mich zur Seite werfend, meinen Wauz nicht loslassend, Ferro zu befreien.
Hier liegen wir nun, beide zitternd vor Anstrengung und Angst. Ferro mit Frauchen, zwei schwarze, schmutzige, stinkende Seelen. Alle Energie in diesem Moor lassend, völlig erschöpft, halte ich meinen Freund eng, ganz fest umschlungen, weine und lache gleichzeitig. „Danke“ flüstere ich „Danke“!
Dieses Wetter muss voll ausgenutzt werden. Die Sonne scheint, es sind angenehme 26° und eine laue Brise weht vom benachbarten Botanischen Garten Blütenduft herbei. Wir - dass sind meine Eltern und meine vier Jahre jüngere Schwester Tanja und ich - genauer gesagt meine Eltern, sind seit diesem Frühjahr Mitglieder des einzigen Tennisclubs unseres 40.000 Seelen Ortes. Hier verbringen sie seither jedes Wochenende, ach was, gefühlt jede freie Minute an diesem Ort der Selbstertüchtigung. Dito meine Wenigkeit, wenn ich nicht zur Schule muss, Gitarrenunterricht habe oder mich im Reitstall befinde. Auf dem Tennisplatz „Am Stein“. Er hat sein Ressort auf dem Theresienstein Areal, inmitten eines riesigen Parks.
Während sich unsere Eltern auf einem der zwanzig Tenniscourts in der Kunst des gelben Balles probieren, dürfen wir Kinder an der etwas Abseits gelegenen Ballwand unbeschwert versuchen, zukünftige Ilie Nastase‘s zu werden.
„Kommt, lasst uns ein Eis holen“. Spontan stimmen wir Anderen Sabine, diesem Wirbelwind zu und rennen übermütig zum Clubhaus, welches von einem älteren Pächter und seiner Frau betrieben wird. Wie 10 / 11 jährige Kinder eben so rennen … sich schubsend, dabei lachend, blödelnd, unbekümmert sorgenfrei. Jungs und Mädchen gemischt.
Im Clubhaus gibt es eine Theke, an der seitlich ein großes Poster mit den verschiedensten Eissorten und den entsprechenden Preisen versehen, hängt- Nogger 80 Pfennig, Dolomiti und brauner Bär je 50 Pfennig, Domino 60 Pfennig, Capri. Ich wähle „Capri“ für 40 Pfennig aus. Ich liebe den etwas süß klebrigen Geschmack nach Orange. Bei dem Wetter genau das Richtige.
Da wir Kinder nie Geld einstecken haben, werden Verzehr wie Limo, Eis und Co stets auf einem Deckel unserer Eltern notiert, welcher am Ende des Monats beglichen wird. Jetzt bin ich an der Reihe. „Ein Capri bitte. Es wird auf Herrmann Schädlich aufgeschrieben.“ Mitten im überreichen aus der vor Kälte dampfenden Eistruhe, stockt der Pächter inmitten seiner Bewegung verharrend und sieht mich fragend mit hochgezogenen Augenbrauen an „Für wen bitte? „Herrmann Schädlich!“ „Aber wer bist du denn? Dich kenn ich nicht! Geht das denn überhaupt in Ordnung?“ „Hhmm Ja, das geht in Ordnung, ich bin die Tochter.“ „Aber du bist doch nicht dem Herrmann seine Tochter! Die kleine Süße mit dem dunklen Wuschelkopf, die Tanja, die kenn ich. Na da, muss ich erst einmal nachfragen, denn so wie du aussiehst, sicher? Ganz sicher nicht … .“ Ich erstarre.
Meine Freunde sehen mich an. Keiner sagte jedoch ein Wort. Keiner sagt mir zu Hilfe eilend „Ja, das stimmt schon“.
In diesem Moment zerbrach etwas in mir. Mein ganzer Körper fühlte sich plötzlich ganz heiß an. Meine Handflächen prickelten. Mein Gesicht glühte. Meine bisherige Unbeschwertheit verschwand. 180° Wende im Blick auf mich selbst. „Bitte lieber Gott, lass den Boden unter mir auftun.“ 40 Pfennig! Wie aus dem Nichts, ohne Vorwarnung. Der Bruch in meinem jungen Leben.
Zeitreise: Wenn ich nicht mit meinen Freunden zum Beispiel im Reitstall bin, oder unserer alten Nachbarin beim Einkaufen helfe und ihr vorlese, weil sie nicht mehr so gut sehen kann oder ich mein Zimmer nicht gerade - sehr zum Leidwesen meiner Eltern zum 100 ten Mal umdekoriere, spiele ich mit meiner kleinen Schwester mit unseren Barbiepuppen. Oft lese ich ein neues Buch, welches ich mir aus der Stadtbücherei leihe. Oder, wenn Mama nicht gerade ihre Nähmaschine selbst in Beschlag nimmt, nähe ich aus Stoffresten Kissenbezüge, Barbiekleider, oder ein Stoffspielzeug, welches ich auch schon mal in der Nachbarschaft, um mein mageres Taschengeld aufzubessern, für je Eine Mark verkaufe. Mama hat mir das Nähen beigebracht. Sie kann das richtig gut. Sie näht meiner Schwester und mir, als auch für sich selber Anziehzeugs. Wobei ich die Sachen für meine Schwester viel hübscher finde. Erst letztens hat Tanja einen tollen rotgelb karierten Swingmantel bekommen. Für mich blieb leider nur Stoff für eine lodengrünen Jacke übrig. Tendenz unauffällig, diskret. So fall ich wenigstens nicht auf. Papa trägt auch fast ausschließlich Beige und Grün. Naja, er muss ja auch Tag für Tag auf irgendwelche Baustellen und seine Leute kontrollieren. Und auf Beige und Grün sieht man den Staub nicht so, hat Mama mir erklärt. Bin ich staubig? Das einzige an mir, was irgendwie staubig aussieht, sind meine straßenkötterblonden aschblonden - ich sag immer arschblonden - Haare, welche ich aus praktischen Gründen immer zu Rattenschwänzen gebunden bekomme. Inklusive einem ultrakurzen Pony, welchen Mama mir in einer beängstigenden Regelmäßigkeit mit der Haushaltsschere selbst schneidet. Ich habe noch nie einen Friseursalon von innen gesehen. Guck mir zwar regelmäßig Bilder von Models in einer der vielen Frauenzeitschriften von Mama an, konnte jedoch bisher noch kein Model entdecken, welches meine Frisur trägt. Naja, die Models sind ja darüberhinaus auch noch ultradünn, wie man am Beispiel von Twiggy oder Cheryl Tiegs, welche meinem Papa ziemlich gut gefällt, sieht. Auch hiermit kann ich beim besten Willen nicht dienen - pummelig, mit Babyspeck um die Taille und Mondgesicht, welches noch durch den Pony extra dahingehend betont wird. Ihr seht schon, die Bezeichnung Schönheit, gilt nicht mir. Aber mit elf Jahren sieht man es nicht ganz so eng. Von dem Wunsch nach einem rotgelb karierten Swingmantel mal abgesehen. Oder? Sind doch alles nur Äußerlichkeiten. Dachte ich. Bis zu diesem Tag. Tja, 180° Wende.
Ich war nie mehr auf dem Tennisplatz. Ich weigerte mich. Jedes Wochenende blieb ich lieber alleine zuhause, als diesen Ort je wieder zu betreten. Als je wieder den Mitwissern meiner Schmach unter die Augen treten zu müssen. Es hat mich von meiner Familie entfremdet. Ich habe ihnen nie etwas gesagt. Ich habe mich so geschämt. Das häßliche Entlein inmitten dieser wunderschönen Familie. Mama - die Schönheit, angehimmelt von der Männerwelt, meine jüngere Schwester ihr Ebenbild, mein Vater der Mann, dem die Frauen scharenweise zu Füßen liegen. Ich wollte kein Störfaktor des perfekten Bildes abgeben. Ich, ein straßenkötterblondes Pummelchen mit Babyspeck um die Taille und rundem Gesicht. Welches Null in diese perfekte Familie passte. Alle in meiner Familie haben dunkle Haare, sind rank, schlank, sportlich durchtrainiert. Wahrscheinlich bin ich doch adoptiert. Der Grundstein meiner Magersucht wurde gelegt. Ich verschwand.
Liebes Tagebuch: ICH HASSE MEINE ELTERN! Zwei Jahre danach vereinbarten meine Eltern einen Termin bei einem Kinderpsychologen, da ich in ihren Augen pupertär extrem anstrengend war, bockig, widerspenstig, trotzig, und zusätzlich jegliches Essen verweigerte. Geholfen hat es nichts. Ich hab zwar im Beisein meiner Eltern begonnen wieder zu essen, jedoch auch schnell herausgefunden, wie dies nicht meiner Figur schadet. Als auch, dass ich versuchte 24/7 „Liebkind“ zu sein, um mir wenigstens ein bisschen Freiheit zu erobern. Neben schulisch zu erwartenden Leistungen, im Haushalt zu helfen, stets pünktlich zuhause zu sein etc. etc. etc., nicht immer einfach. Blöd nur, dass meine ach so putzige kleine, hübsche einschleimerische Petze von Schwester, eine Vorliebe dafür hatte, mich anzuschwärzen und mir oft einen Strich durch die Rechnung machte, indem sie mich wo immer sie eine Chance sah, mir eins auswischte, und jeden Fehltritt, wie nächtliches aus dem Fenster steigen um mich mit Älteren am Bushäuschen zu treffen, um ein kleines Beispiel zu nennen, meinerseits unseren Eltern freudig mitteilte.
Mit 17 ergatterte ich meinen ersten Modelljob, das graue Mäuschen hat sich gemausert. Aus dem häßlichen Entlein wurde ein Schwan. Doch zu welchem Preis? Bulimie und Magersucht klatschten sich abwechselnd ab.
Mit 19 belauschte ich zufällig ein Gespräch, welches mir klar vor Augen führte, dass ich gegen Windmühlen ankämpfe und dass ich nie annähernd so schön sein werde, wie meine Mutter. „Also ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich für die Mutter entscheiden, was für eine Granate. Mit der würde ich zu gerne mal ….!“ Sagt der Mann, in den ich total verknallt bin, der Mann meiner Träume, zu seinem besten Kumpel und lacht. Sein Kumpel nickt zustimmend und fällt breit grinsend in das Lachen ein.
Jetzt, Jahre später weiß ich, ich wollte doch nur dazugehören. Mein sehnlichster Wunsch: eine Schönheit sein, wie Mama oder Barbie. Gemocht zu werden. Auch heute noch assoziiere ich Attraktivität mit Akzeptanz. Möchte das perfekte äußere Bild abgeben.
Hatte immer den Wunsch, um jeden Preis - im wahrsten Sinne des Wortes- die schönste, attraktivste Frau für meinen Partner / Mann zu sein. Was hab ich nicht alles dafür getan. Botox, Fadenlifting, Hyaluron, Brust OP, Kältetechnik gegen den zunehmend fetter werdenden postmenopausalen Bauch. In meinem Bekanntenkreis bin ich diesbezüglich ein kompetentes Versuchskaninchen und Vorreiterin aller möglicher neu entwickelten Schönheitstools und Behandlungen, welche ich, wenn um Rat gefragt, weitergebe.
„Ist es nicht interessant, dass ich aggressiv werde, als auch sofort dessen Partei ergreife, wenn ein Mensch ausschließlich nach seinem Äußeren beurteilt wird?!“ überlege ich gerade laut, während ich diese Zeilen schreibe.
Wenn ich das Geld hätte, würde ich es wie Demi Moore handhaben.
Da dieser Wunsch nach äußerlicher Perfektion jedoch unerfüllbar, unerreichbar - eine harte Lehre - nicht umsetzbar ist, opfere ich mich für Freunde, Patienten, Familie, Partner auf. Bin stets für Jeden mit Rat und Tat zur Stelle. Ein Ersatz für den Anspruch an meinen mir gesetzten Perfektionismus? Menschen lieben mich und fühlen sich in meiner Anwesenheit wirklich wohl. Man schwärmt von mir: Ich bin die netteste, emphatischste, fürsorgliche, aufrechte, verschwiegene, hilfsbereite Person. Jedoch MIR, werde ich nie gerecht.
Das Kind in mir schüttelt verwundert den Kopf „Seltsam, dass ich trotzallem nach wie vor, Capri Eis mag.“
„Du musst etwas finden, was dir hilft, deine innere Mitte wieder zu erlangen“. „Du solltest dich mit Gleichgesinnten zusammentun“. „Hast du es schon einmal mit Qigong probiert? Oder mit Yoga?“ „Was sagt denn dein Arzt?“ „Hast du jetzt schon einen neuen Termin in der Neurochirurgie vereinbart?“ „Lässt du dich jetzt operieren?“ Ich bin mir bewusst, dass all die lieb gemeinten Fragen und Ratschläge meines Umfeldes mir nur helfen wollen. Auch wenn ich ab und an etwas genervt ob der Überfürsorge mit den Augen rolle. Wenn Familie und Freunde mir ihre Unterstützung anbieten, wenn sie mich ansehen, um mir durch die Blume zu sagen, wie scheiße ich aussehe, dass meine dunklen Augenringe nicht von zu viel Kajal kommen und sie sich etwas hilflos fühlen, angesichts der unleugbaren Situation, wenn man mir meine Anspannung anmerkt.
Diese andauernden Kopfschmerzen und diese dadurch verursachte innere unruhige Nervosität machen mich zusätzlich auch noch gereizt, als ob die alltäglichen Belastungswehwehchen in meinem Rücken - „mir geht es wie dem Jesus, mir tut das Kreuz so weh“ blöder Spruch blitzt es in meinen Gedanken kurz auf, nicht so schon reichen.
Hier lieg ich nun auf dem glatten, schon etwas in die Jahre gekommenen Stäbchenparkettboden in unserem Wohnzimmer. Es ist nicht nur der größte Raum im Haus, ich habe auch einen unverstellten Blick hinaus in unseren herrlichen Garten. Unter mir eine perfekt zugeschnittene, zu meinen 178 cm passenden Schaumstoffmatte in einem lavendelfarbenen Ton. „Diese Farbe hat eine zusätzlich beruhigende Wirkung“ versicherte mir der freundliche Verkäufer glaubhaft. Ich war schon immer stark von werbewirksamen Slogans beeinflussbar. Ich bin eine „noch weißer als weiß“, naja, in diesem Fall lavendelfarben zu inspirierende, kauffreudige Kundin.
„Ein Versuch ist es ja wert, schlimmer, kann es dadurch kaum werden“ rede ich mir gut zu.
Hier lieg ich nun auf meiner lavendelfarbenen Yoga - Schaumstoffmatte und nichts engt mich ein. Weder meine schon etwas aus der Form geratene blau verwaschene Legging, noch mein weißes lockeres Baumwoll-T-Shirt. Ich bin barfuß. Meine langen blonden Locken habe ich mit einem sog. Scrunchie locker zu einem hohen Dutt, wie man bei uns in Bayern so charmant sagt, zusammengeschnerpfelt,.
„Gut, dass mich sooo keiner sieht“, insistiert mein allseits optisch gepflegtes Äußeres ICH grummelnd vor sich hin.
Mein I Pad ist in Position gebracht, so dass ich stets, einen guten Blick darauf werfen kann, um den Anweisungen der/ des jeweiligen Trainerin, welche ich mir ausgesucht habe, bewusst nachüben kann.
Gestern „Bodychallenge - in 28 Tagen zur Strandfigur“. „Haha, Schön wär’s, wenn ich auch noch meine Schokoladenliebe damit bezwingen kann und nicht schon Ü50 wäre“ murmel ich und zweifelte schon etwas an Tag Eins den Kauf, dieser mir doch so heiß angepriesenen App an. Doch so schnell aufzugeben, ist für mich keine Option. „No way, no way, lets get started“ summe ich falsch vor mich hin. Heute an Tag Zwei entscheide ich mich aufgrund meiner angespannten Schulter- und Rückenpartie für „somatisches Yoga mit Anna“. Diesbezüglich mag ich diese App, da sie mich selbst aussuchen lässt, was ich im jeweiligen IST Zustand benötige. Ein kleiner Fingertouch startet das etwa 20 minütige Programm, mit 20 sogenannten Asanas.
Ich liege hier, meine langen Beine flach ausgestreckt, meine Handflächen ruhen entspannt neben mir. „Da hat auch schon lang keiner mehr den Staubwedel geschwungen“ denke ich laut beim Blick in die linke obere Ecke. Inhale … exhale, die Augen geschlossen. Bewusst atmen. Bisher war mir nicht klar, dass ich verlernt habe, wie es sich anfühlt tief und vor allem bewusst ein- und auszuatmen. Im Hintergrund der Session spielt leise eine beruhigende, etwas mystische Musik, während Anna mit entspannter Stimme verschiedene, ineinander gleitende Anleitungen gibt, unterdessen sie die einzelnen Übungen, welche uns den Schülern vor dem Bildschirm helfen soll, vormacht.
Ich lasse mich komplett darauf ein. Zentriert, fokussiert mein Sein in der Balance zu halten. Was mir, wie ich mir selbst eingestehen muss, nicht immer leicht fällt. Ein kleines Loch in der Innennaht meiner Legging lenkt mich kurzzeitig ab, irritiert meine Konzentration und zack verliere ich fast mein Gleichgewicht, als ich versuche in aufrechter Stellung nur auf einem Bein sicher stehen zu bleiben, während der linke Fuß auf der Aussenseite meiner Wade ruhen soll. „Uppsala“ entfährt es mir, so dass ich mit meinen beiden Armen rudernd nachhelfen muss, welche eigentlich zu einer Krone über meinem Kopf zusammengeführt sein sollten, damit diese Übung „the tree“ mich in aufrechter Stellung einfüßig mit Mutter Erde verbindet.
Einatmen, ausatmen, das Atmen nicht vergessen, den eigenen Körper spüren. Noch suche ich meine Mitte. Von meinem Kopf beginnend, über die Schultern, meine geschundene Wirbelsäule hinab, über meine Hüften, beide Beine entlang, bis hin zu meinen Füßen, den eigenen Körper mit fließenden Bewegungen punktuell wahrnehmen, um zu einer Einheit geführt zu werden. „Well done, good job, move into mountain pose“, werden wir Schüler von Anna nach getanem Asana gelobt. Überrascht stelle ich fest, dass ich mich gut fühle.
Nach zwanzig minütigen wohltuendem Yoga, ist mein Körper angenehm durchblutetet, warm. Ich lasse meine Gedanken fließen. Lasse zu, dass sie zur Ruhe kommen. „Einatmen Inhale, Ausatmen Exhale.“ spricht mein Mantra. Unverhofft verschleiern Tränen meinen Blick und doch fühle ich mich tatsächlich gut. Bin dankbar. Dankbar für die Me time, dankbar, für meine Freunde und Familie, welche in ihrer Hilfe nie nachlassen und mich auch mal aus meiner Komfortzone schubsen. Ich verharre noch einen Moment liegend auf meiner lavendelfarbenen Yogamatte, erhebe mich dann langsam und bedächtig. Stehe aufrecht, den Blick klar, lege ich meine Handflächen vor der Brust - unserem Herz Chakra - aneinander, neige meinen Kopf, spüre die Energie, erweise mir Respekt und flüster leise „Namaste“.
Ich sitze entspannt Musik hörend am Wegrand auf einer Bank. Die Sonne scheint mir ins
Gesicht. Vor mir Hügel, Weite, und die Herbstluft riecht nach Erde und Regen. In meinen
Earphones beginnt durch Zufallsmodus „Komm, lass uns leben, lass uns lieben, das Leben
ist gar nicht so schwer“ von Westernhagen zu spielen. Es ist „unser Lied“.
Und es katapultiert mich, wie jedes Mal, mehr als 30 Jahre zurück. Zurück zu einem
anderen Leben, zu einem anderen Ich. Was wäre gewesen, wenn …?
Es ist Sommer, und die Hügel des Schwarzwalds leuchten in einem satten Grün. Ich lebe in
einem kleinen beschaulichen Ort, umgeben von Weinbergen, Feldern und Mischwäldern, in
denen ich gerne auch Abseits des Touristentrubels spazieren gehe. Es hätte eine Zeit der
Ruhe und Zufriedenheit sein können – aber innerlich bin ich längst verloren, bin in einer
Farce von Ehe gefangen. Sie ist ein Trümmerhaufen, ohne Zuneigung, Verständnis oder
Respekt und ist, wenn ich ehrlich zu mir bin, nie eine wirkliche Ehe gewesen. Ich habe
viel gegeben, um ein „Wir“ zu retten, das es jedoch nie gab. Aber das ist eine andere
Geschichte.
Und dann kam Alexander.
Ich warte auf meine Freundin in dem kleinen Stammcafé am Hang, als er hereinkommt. Er hat
diese Ausstrahlung, die den Raum für einen Moment still werden lässt.
„Verdammte Scheiße“, denke ich „von welchem Planeten ist der denn entsprungen. WOW.“ Ich
starre ihn regelrecht an, als sich unsere Blicke treffen, und ich spüre etwas, das ich
lange nicht mehr gespürt habe: Leben. Er spricht mich an, wir reden, und reden und reden
und ich verliere mich immer mehr in dieses Charisma und einem Gefühl von Aufmerksamkeit,
ehrlichem Interesse an meiner Person und ahne nur vage was da gerade passiert.
Diese unvorhergesehene Begegnung verwandelt sich in vier Tage voller Gespräche, Lachen
und intensiver Nähe. Es bleibt nicht nur bei Worten – wir lieben uns, als gäbe es kein
Morgen. Verrückt, sehnsüchtig, leidenschaftlich. Ich habe das Gefühl, endlich wieder frei
atmen zu können, nach Jahren, in denen ich nur neben mir existiert, funktioniert hab.
Es ist ein Rausch, der mich mitreißt, ein Rausch, der alles übertönt.
Doch am vierten Tag sagt er die Worte, einen Satz, den ich nie hören wollte. Die
Vorstellung von einer gemeinsamen ewigen Zeit, die Illusion daran zerbrach: „Ich bin
verheiratet.“ „Das hier, hätte nie passieren dürfen.“ „Ich habe mich in dich verliebt.“
Es fühlt sich an, als würde ich auf einen Abgrund zu rennen, ohne es zu merken. Doch es
ist zu spät. Ich bin zu tief drin, zu verliebt, zu hungrig nach diesem Gefühl von Leben,
nimmersatt nach ihm. Vielleicht hätte ich es besser wissen müssen.
Drei Jahre zuvor hatte ich einen „Geist“ besiegt, und ich hatte mir geschworen, mein
Leben von nun an voll auszukosten. Aber stattdessen finde ich mich in einer Lüge wieder,
in der ich mich selbst verrate. Ich klammere mich daran, an diese verzweifelte Hoffnung,
dass Liebe für mich allein genug sein kann. Ich will nicht sehen, was klar vor meinen
Augen liegt – dass es keine Zukunft gibt.
Was folgt, ist eine heimliche Liebe, die im Schatten lebt. Keine gemeinsamen Urlaube,
Feiertage oder spontanen Aktionen.
Heimliche Fahrten nach Unna, wo er wegen seines Jobs ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft
hat. Nächte, die sich unendlich anfühlen, bis ich wieder fahre. Oder er sich auf dem Weg
zu seiner Familie nach Willingen macht. Ich will nichts von dem „anderen Leben“ wissen.
Ich will nur diese Momente, unsere gestohlene Zeit anhalten, festhalten. Er und ich.
Ein halbes Jahr später wage ich den großen Schritt: Ich verlasse meinen Mann und ziehe
nach Münster, da hier ein Teil meiner Familie lebt und es näher an Unna ist.
Alexander kommt jetzt fast täglich, außer an den obligatorischen Wochenenden oder an
Feiertagen zu mir. Für zwei Jahre leben wir in unserer Oase, unsere große, versteckte
Liebe. Es ist nicht perfekt, aber ich rede mir ein, dass es genug ist. Ich sage immer:
„Ich nehme dir nichts weg. Ich gebe mich dir dazu. Ich bin hier, solange du mich willst.“
Und ich glaube wirklich, dass das Liebe ist. Doch in Wahrheit ist es Naivität. Eine
Selbstverleugnung, die ich erst viel später erkennen werde.
Dann kommt der Tag der ungeschminkten Wahrheit. Eines Tages, als ich seine Brieftasche
öffne, um Geld zu wechseln, finde ich eine Visitenkarte. Es war nur ein Name,
handgeschrieben eine Telefonnummer, nur eine Adresse, aber sie lässt mich nicht los. Als
ob mir mein siebter Sinn stetig etwas sagen will.
Kurz darauf beginnen sich seine Ausreden zu häufen, weshalb er nicht mehr so oft nach
Münster kommt: Fortbildungen, familiäre Verpflichtungen. Etwas in mir weiß, dass da mehr
ist, aber ich weigere mich, es zu sehen. Ich will diese Welt, und wenn sie noch so
scheinheilig ist, unsere kleine Welt, die wir zusammen aufgebaut haben, nicht verlieren.
Eines Tages, als er wieder einmal kurzfristig absagt, überrede ich von Unruhe getrieben
einen treuen Freund mit mir zu der Adresse auf der Visitenkarte zu fahren.
Wir warten, ich sitze versteckt im Fussraum des Beifahrersitzes, in einem fremden Auto.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt Alexander und ich sehe, wie er aus seinem Wagen
steigt, zur Haustür geht. Eine blonde Frau öffnet ihm die Tür, fällt ihm lachend in die
Arme, er fängt sie auf, wie er mich immer auffängt, sie küssen sich und er verschwindet
in ihrem Haus.
In diesem Moment zerbricht etwas in mir. Ich will aus dem Auto springen, klingeln,
schreien, ihn zur Rede stellen. Aber ich tue nichts. Ich bleibe stumm, wie gelähmt, nur
innerlich schreie ich. Wir fahren zurück, und ich liege die ganze Nacht wach, unfähig zu
fühlen. In Endlosschleife drehen meine Gedanken durch. Es gibt noch eine weitere Frau
neben mir und seiner Ehefrau. Ich übergebe mich. Mir ist kalt.
Am nächsten Tag kommt er wie vereinbart zu mir, nimmt mich wie immer in die Arme und
sagt: „Ich hab dich so sehr vermisst.“ Und ich? Ich lächle, „und ich dich!“, als wäre
nichts gewesen. Ich will die Lüge glauben, mehr als alles andere.
Ich schlafe nicht. Mir ist nur noch schlecht. Ich esse nichts, mein Gedankenkarussell
wälzt sich hin und her. Zwei Wochen später erfahre ich, dass ich schwanger bin. Zum
ersten Mal seit Langem fühle ich wieder so etwas wie Hoffnung. Doch ich sage ihm nichts.
Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Stolz, vielleicht aus Trotz, vielleicht weil ich
endlich etwas habe, das nur mir gehört? Vielleicht, weil ich möchte, dass er sich für
mich entscheidet und nicht nur für mich, aufgrund unseres ungeborenen Kindes.
Doch dann kommt Weihnachten, und ich verbringe die Feiertage wie immer ohne ihn, bei
meiner Familie. Es ist ein stilles Fest, obwohl meine Familie sich die allergrößte Mühe
gibt, dass ich mich aufgehoben, geborgen bei ihnen fühle. In mir jedoch tobt ein Sturm.
Am Morgen des 25. Dezembers verliere ich unser Kind.
Ich sitze allein in meinem alten Kinderzimmer und fühle nichts als Leere.
Das war der Moment, in dem ich weiß, dass ich kämpfen muss – nicht um ihn, sondern um
mich selbst. Um meiner Selbstwillen kann ich nicht so weitermachen.
Januar, neues Jahr. Zurück in Münster ruft Alexander wie erwartet an. Er sagt, er
vermisst mich, die Feiertage ohne mich waren so zermürbend, aber auch, dass ihm alles
über den Kopf wächst. Ich verstehe – drei Frauen sind für den Superman zu viel. Ich kann
nicht mehr.
Ich bitte ihn, seine Sachen abzuholen und den Schlüssel dazulassen. Ich erzähle ihm
nichts – weder, dass ich von der anderen Frau weiß, weder von der Schwangerschaft, noch
von der Fehlgeburt.
Er und alles, was je zwischen uns war, ist ein Kapitel, das ich schließen muss, um nicht
selbst daran zugrunde zu gehen.
Manchmal höre ich „Komm, lass uns leben“ von Westernhagen im Radio, und jedes Mal fühle
ich mich zurückversetzt. Zurück zu diesem Sommer im Schwarzwald, „Wünsche werden wahr“
denke ich verträumt bei mir und blicke zu dem größten Vollmond, den ich je gesehen habe.
Wir sind auf einem Weinfest, sind betrunken vom Wein und vom Glück, lachen, und ich fühle
mich so unbeschwert und frei.
Dorthin, wo alles begann.
Heute sehe ich Alexander ab und an auf Facebook. Wir liken ab und zu die Stories des
anderen, aber wir schreiben uns nicht. Außer an unseren Geburtstagen. Er lebt jetzt als
Rentner auf Mallorca, mit oder ohne die Frau, die ihn damals gewann. Ich weiß es nicht
und möchte es auch nicht wissen. Sie hatte damals, wie ich später erfuhr, ebenfalls
zeitgleich schwanger wie ich, um ihn gekämpft.
Etwas, das ich nicht konnte.
Vielleicht hätte ich kämpfen sollen. Vielleicht hätte ich ihm die Wahrheit sagen sollen.
Aber damals hatte ich keine Kraft mehr. Der Verrat, die Lüge. Der überstandene Schatten,
die Angst vor dem Wieder – so Vieles lähmte mich.
Heute weiß ich, dass mein Kampf ein anderer war. Es war der Kampf, mich selbst nicht zu
verlieren. Es war der Kampf, weiterzugehen, trotz allem. Leben bedeutet nicht immer, zu
kämpfen, um etwas zu halten. Manchmal bedeutet es, loszulassen. Und manchmal bedeutet
Liebe, sich selbst genug zu sein.
Amadeus war kein gewöhnlicher Hamster.
Er war dick, pausbäckig, braun-weiß – und so gierig, dass er selbst in
einer vollen Futterschale noch etwas fand, das er unbedingt in seine
Hamsterbacken retten musste.
Er sah aus wie ein Keks mit Beinen – aber wehe, man täuschte sich.
Der Kerl war gierig.
Immer.
Bis Ultimo.
Er hörte auf seinen Namen, wenn er wollte.
Meistens dann, wenn jemand „Amadeus!“ rief und eine Erdnuss in der
Hand hielt. Ansonsten ignorierte er alles, was nicht vibrierte und sich
anhörte wie das kamplustige Quietschen seines heißgeliebten Laufrads.
Und dann war da dieses feuerrote Spielzeugauto, elektrisch gesteuert,
sein ganzer Stolz.
Er schmiss sich hinein wie ein Rennfahrer, der wusste, dass er zu groß
für das Cockpit war, aber sich trotzdem reindrückte: Bauch voran,
Backen hinterher.
Maul voll Futter. Reserverationen.
Blick wie ein Mafia-Boss im Mini-Format.
Er liebte Macht.
Und Snacks.
Und Geschwindigkeit.
In genau dieser Reihenfolge.
Und genau so begann ein Nachmittag:
mit einem Hamster, der fand, dass Regeln sowieso überschätzt werden,
einem roten Spielzeugflitzer, und Hundehaaren auf einem Pullover.
Amadeus ließ sich anstandslos mitnehmen – unter einer Bedingung:
Er durfte in seinem feuerroten, elektrisch gesteuerten Spielzeugauto
sitzen.
Das Auto war ein Geschenk der älteren Nachbarin, die ihn fütterte, wenn
Lea länger arbeitete.
Weil Amadeus sonst, wie sie immer sagte,
„in ein Hungerkoma fällt, der arme Schatz.“
Lea schnallte seinen Mini-Flitzer sorgfältig auf dem Beifahrersitz fest.
Sicherheit geht vor.
Und obwohl er normalerweise der Typ Hamster wäre,
der sich lieber, wie Lando Norris im Flitzer fläzt,
lässt er sich anschnallen –
mit dieser „Na gut, majestätischen meinetwegen“-Würde,
die nur er besitzt und erträgt es mit königlicher Gelassenheit.
Sie startete ihr Auto.
Der Schlüssel war diesmal nicht verschwunden – ein kleines Wunder.
Vermutlich hatte Amadeus vergessen, ihn zu klauen, weil er mit dem
roten Lenkrad beschäftigt war.
„Bereit?“, fragte Lea.
Amadeus blieb ernst.
Dann legte er eine Pfote entspannt an die Armlehne seines Autos, wie
ein kleiner Rennfahrer, der auf dem Weg zu einem Interview ist.
An diesem Nachmittag musste Lea mit ihm zum Tierarzt.
Routinecheck.
Oder wie die Helferinnen immer schmunzelnd sagten:
„Seine kleine Hoheit beehrt uns wieder.“
Und jedes Mal klang darin ehrliche Begeisterung. Er war aber auch zu
knuffig.
Im Wartezimmer der Tierarztpraxis ertönte sofort ein kollektives
Quietschen:
„Amadeuuuuss!“
Der Star war da.
Der König.
Der Backen-Boss.
„Oh, wie entzückend ist das denn?“, rief eine der Helferinnen, als sie ihm
Leckerlis zusteckten.
Er nahm jedes Stück mit seinen kleinen Vorderpfoten höflich an – und
stopfte es danach gnadenlos in seine Backen, bis er aussah wie ein
überfüllter Süßwarenautomat.
Lea setzte sich daneben, bereit für das gewohnte Spektakel, als plötzlich
jemand neben ihr Platz nahm.
Ein Mann. Warm lächelnd.
Hundefell am Pullover.
Kaffeebecher in der Hand.
Hundeleine locker ums Handgelenk geschlungen.
Augen so weich, dass selbst die Neonbeleuchtung der Praxis Mühe
hatte, sie hart wirken zu lassen.
„Zahnreinigung“, sagte er. „Er liegt noch in Narkose. Ich warte, bis er
wieder wach ist.“
Lea nickte mitfühlend.
„Oh je… das klingt schlimm. Als würde man warten, dass das eigene
Kind aus dem OP kommt.“
Dann sah er zu Amadeus, der sein rotes Mini-Auto vor sich herschob, als
würde er um die Pole-Position kämpfen.
Die Helferinnen filmten ihn heimlich – Amadeus tat so, als sei das alles
nur der normale Applaus seines Publikums.
Der Mann verschluckte sich fast an einem Schluck Kaffee.
„Ist das… Ihr Hamster?“
Lea schnaubte, mit dem Kopf schüttelnd.
„Ja. Also… ja. Er gehört zu mir.“
Der Mann grinste. „Ich glaube, er weiß das ganze Wartezimmer sehr gut
zu unterhalten.“
Amadeus drehte sich genau in diesem Moment um, hob eine Pfote –
ganz langsam, als wäre das hier seine persönliche Pressekonferenz –
und sah aus, als hätte er jedes Wort gehört und sofort für angemessen
befunden. Dann knackte er demonstrativ ein Leckerli.
Der Blick, den er ihnen anschließend zuwarf, sagte klar und trocken:
Ich arbeite hier.
Der Mann lachte leise.
„Ich glaube, er hat mir gerade zugezwinkert.“
„Kann sein“, sagte Lea. „Er hält sich für Amor.“
Amadeus stoppte in seiner Wartezimmerrunde hielt inne, guckte mit
seinen Knopfaugen in ihre Richtung „Na los, Mensch. Ich habe dich bis
hierhergefahren. Mach was draus.“
Später, auf dem Rückweg, saß Amadeus wieder in seinem roten Flitzer,
Backen voll, Herz zufrieden. Der Mann aus dem Wartezimmer hatte sie
nach ihrer Nummer gefragt.
Ganz unverkrampft.
Ganz selbstverständlich.
Ganz… passend.
Lea hatte seine Nummer eingespeichert, Thorsten, 0173 888 502*
Sie lächelte, fuhr los und murmelte:
„Wenn Liebe im Spiel ist, braucht es manchmal nur einen Hamster, der
den ersten Schritt macht.“
Amadeus nickte.
Oder seine Backen wackelten beim Kauen.
Schwer zu sagen.
EPILOG – Für Amadeus
Es gab ihn wirklich, meinen Amadeus.
Er war mein dickbackiger Kindheits-Hamster,
flauschig, frech – und mit einem Herzen,
das größer war als er selbst.
Mein Bruder hatte damals ein rotes Spielzeugauto mit Fernsteuerung.
Und ja … wir setzten Amadeus hinein.
Oft. Ziemlich oft.
Und er ließ es über sich ergehen:
mit dieser unverwechselbaren Mischung aus Würde und beleidigter
Gelassenheit,
die nur Hamster beherrschen.
Wenn man seinen Namen rief,
kam er tatsächlich angewackelt.
Mit Backen voller Futter
und dieser Selbstverständlichkeit,
als wäre er ein Hund im Hamsterpelz.
Ich war mein Leben lang von Tieren umgeben.
Deshalb sind mir Tierarztzimmer vertraut –
Routine, Kontrolluntersuchungen,
kleine Eingriffe, manchmal auch das Abschiednehmen.
Und ja:
auch die netten, manchmal überraschend tiefen Gespräche mit
Menschen im Wartezimmer gehören dazu.
Heute gehe ich mit meinem eigenen Hund
zu Kontrolluntersuchung, Impfterminen und manchmal muss ich dabei
schmunzeln und an diesen kleinen, pausbackigen Kapitän im roten Auto
denken.
Diese kleine Geschichte widme ich ihm –
dem bezauberndsten, dickpausbackigsten
und frechsten Hamster, den man sich nur vorstellen kann.
Mal ganz unter uns: Ela müsste Eintritt nehmen. Für ihre Taschen. Wirklich. Wer einmal hineinschaut, hat das Gefühl, er sei durch ein Portal in eine Parallelwelt gefallen – eine Welt, in der Chaos und Organisation eine sehr seltsame, aber funktionierende Ehe führen.
Im Grunde wollte Ela ja immer nur kurz raus. Nur mal eben.
Zum Bäcker. Zur Physiotherapie. Zum nächstgelegenen Supermarkt. Zu einer ihrer Lesungen. Zur Freundin. Aber „nur mal eben“ trägt bei Ela Bedeutung.
Ela trägt nämlich immer zwei Taschen. Das ist kein modisches Statement, das ist ein Lebenskonzept.
Eine kleine Crossbody, die so unschuldig aussieht wie ein Haferkeks – und je nach Anlass eine große Business Tote, Shopper- oder Big-Designertasche, die eher den Verdacht wachrufen, Ela könne jederzeit eine Expedition nach Patagonien planen, bzw. sie könne damit jederzeit in einen Flieger steigen und notfalls ein neues Leben an der Amalfi Küste oder in Lissabon beginnen. Ohne noch mal nach Hause zu müssen.
Die kleine Tasche alias „Ich verliere nichts mehr, hörst du? NICHTS.“
In der Crossbody wohnt ihr Handy, natürlich. Und ihre Air-Pods, die mit einem Air-Pod-Halteband auf immer und ewig verbandelt sind, als könnten sie sich sonst selbstständig machen.
Einmal sind sie ihr nämlich, lautlos wie zwei weiße Maikäfer unbemerkt aus den Ohren gefallen, und erst als ein älterer und äußerst freundlicher Herr hinter ihr herrief:
„Entschuldigung! Sie verlieren da… etwas Weißes! Aus Ihrem Ohr!“ wurde das herannahende Unglück vorzeitig gebannt. Seither hängen sie bei Benutzung an einem dünnen schwarzen Band, um ihren Nacken, gesichert wie zwei Dinge, die dazu neigen, sich klammheimlich aus dem Staub zu machen.
Vorsorge war alles. Vorsorge war Frieden.
Zwischen Handy und Stöpseln wohnt ebenfalls ein DIN – A 8 Päckchen Taschentücher. Für Tränen, Lachen, Schnupfen, kalte Zugluft oder Hunde, die ihre Schnauze ungefragt in Richtung Herz schieben. Die kleine Tasche ist Elas Schnellzugriff: das Leben in der Kurzversion.
Doch die wahre Geschichte, das eigentliche Epos, spielt sich in der
„Big Bag“ ab.
Wenn Ela je nach Anlass eben diese große Tote, den Shopper- oder die Big-Designertasche über ihre Schulter wirft, nimmt sie nicht nur Dinge mit. Sie trägt ihre Art zu leben. In dieser Tasche steckt kein Inhalt, sondern eine Haltung: spontan, aber vorbereitet. Chaotisch, aber organisiert.
Ein Kosmos mit Reißverschluss.
Die große Tasche ist eine gänzlich andere Nummer.
Ein Raum. Eine Landschaft. Ein Phänomen.
Einer Frau, die allzeit parat, bereit ist wie Santa Claus und Knecht Ruprecht zusammen am 6. Dezember.
Dort drin wie sie sagt, ihr „tragbares Ordnungssystem“. Ein praktischer umfunktionierter Schuhsack der Modefirma mit großem Z, den sie einfach von einer Tasche in die nächste hebt, weil niemand so lebensunklug ist, jedes Mal fünfzig Teile einzeln umsortieren zu wollen.
Ich sage: ein optimistischer Versuch.
Darin findet man, ganz selbstverständlich:
Ein Notizbuch. Lebensnotwendig. Ein Tresor ihrer Gedanken. Denn Autorinnen ohne Notizbuch sind wie Köche ohne Pfannen. Wie ein Zug ohne Schienen.
Ein Glitzerkugelschreiber, der aussieht, als hätte ein Einhorn in Swarovski gebadet. Er trägt so viele kleine Steinchen, dass er im Licht glitzert, als würde er jede Idee mit Applaus begrüßen.
Direkt daneben schlummert das Handy-Ladegerät UND ein To-Go-Ladegerät („Man weiß ja nie. Wirklich nie.“). Das portable, für „Fälle“, wie sie sagt. Fälle, in denen das Leben interessanter ist als die Akkuanzeige.
Eine Sandblattfeile, falls sich ein Fingernagel, definitiv immer im unpassendsten Moment, in den Suizid stürzen möchte.
Einen Mückenstich-Stick: im Sommer ein heiliger Gral, reist aber das ganze Jahr mit – sicher ist sicher (Ich sag nur Amalfi Küste).
Und – natürlich! – die erste Kastanie des Jahres die Ela findet. Das Glücks-Abo der Natur.
Sie bleibt genau zwölf Monate bei ihr, weil sie Glück bringen soll. Und weil sie sich nach Kindheit und Herbst anfühlt, nach raschelnden Blättern und Hosentaschen voller Geheimnisse.
Dann der Schlüsselbund. Ganz Meerbusch könnte damit abgeschlossen werden. Wenn der Schlüsselbund sich meldet, klingt es, als würde ein kleines Xylophon angeschlagen.
Elf Schlüssel. Menschen mit weniger würden von Minimalismus sprechen. Kein Mensch weiß, wofür alle sind. Ela schon. Elas Realität. Also zumindest theoretisch.
Das augenärztliche Attest, dass sie ohne Brille Auto fahren darf, steckt da auch drin. Nach jahrzehntelangem Brillen- und Kontaktlinsentragen fühlt sich dieses Papier fast wie ein kleiner Triumph gegen das „Altern“ an. Und wenn das jemand schmeichelnd erwähnt, kommt Elas trockenes Schulterzucken: „ICH sehe gut. Ich verlege nur permanent die Beweise.“
Auch irgendwo – sorgfältig verstaut im durchsichtigen Zipperbeutel der kleinsten Einheit ihres Taschen-Matrioschka-Systems – die unerlässliche Notfallversorgung, die persönliche Drogerie-To-Go.
Der wahre Anfang pragmatischer und effizienter Fürsorge:
Nasenspray (wegen verstopften Überlebens).
Manukabonbons (wegen Stimme, wenn diese viel aus Herzzeitlos vorgelesen hat).
Zahnseide (wegen Zahnhygiene und unangenehmer Zungenpuhlerei).
Reisezahnbürste (falls das Leben spontan entscheidet, dass man nicht im eigenen Bett schläft).
Haargummi (falls der eigentliche wieder einsam im Bad zurückgelassen wurde, da der Physiotherapeut ansonsten den verspannten Nacken auslässt).
Haarklammern (obwohl sie diese ziependen Dinger nicht mag).
Listerine-Spray für den Fall, dass spontane Nähe gefordert ist.
Augentropfen für windige, staubverwehte Wege.
Desinfektionsmittel - gegen all diese grenzüberschreitenden Flächen der Zivilisation: Türklinken, Einkaufswagen, Rolltreppen-Griffe – alles Orte, an denen sich Mikroben vermutlich duzen.
Lippenpflege „weiche Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da … la la la“.
Eine Tube Handcreme – gegen Sommersprossen, die sich neuerdings wichtigmachen, dunkler tun, als sie sind und im Laufe der Jahre beschlossen haben, Karriere als ‚Altersflecken‘ anzustreben.
Pflaster: Helfer gegen heimtückische Papierkanten-Attacken oder bösartige, gleichwohl hinterlistige scharfe Messer.
Kopfschmerztabletten, weil man nicht zulassen sollte, dass ein schöner Tag zu früh endet.
Ein kleiner Schutzengel, den sie von ihrer BFF geschenkt bekommen hatte, ruht zwischen den Dingen wie ein talismanischer Begleiter, der selten auffällt, aber immer da ist.
Und irgendwo raschelt eine Tüte Hundeleckerli – natürlich zuerst für ihren eigenen #bestBuddy, aber genauso für jeden anderen Vierbeiner, der neugierig, mit leidend verhungerndem Blick angetapst kommt und dessen Halter zustimmend nickt. Hunde gehen bei Ela nur dann leer aus, wenn der Mensch am anderen Ende der Leine streng ist. Dann bekommt der Hund wenigstens einen solidarischen, mitfühlenden Blick.
Und – wichtig – eine Lesebrille.
Und dann: das Portemonnaie.
Ein in Schwarz gewandeter Leder-Bodyguard dessen Initialen MK – ein Roman für sich ist. Ein versiegeltes Geheimnis, das bereit ist, sich zu zeigen. Groß, länglich. Goldapplikation. Mit Reißverschluss, der klingt wie eine Enthüllung.
Darin alles ordentlich verstaut: Bargeld (immer ausreichend, in beeindruckender Verlässlichkeit. Ein Prinzip, das sie niemals aufgibt). - Karten, in Reih und Glied – Kreditkarten, Payback, Douglas, Fitnessstudio, Bücherei, Clubmitgliedschaften und eine kleine Armee weiterer Plastikkärtchen. Ordentlich einsortiert, als hätten sie auch feste Schichtzeiten und den stillen Ehrgeiz, wie Beamte kurz vor der Pensionierung.
Div. Ausweise, Führerschein- nach 40 Jahren nicht mehr in zerfleddertem Grau, sondern handlich, klein, in schillerndem Blau. KFZ-Schein, Parkzettel, Belege (hähä … die nächste Steuererklärung darf sich darauf freuen).
Ihre Visitenkarten – diese kleinen Pappstücke mit Charakter, auf denen ‚Ela – Herz & Wort Autorin‘ steht. Karten, die so würdevoll im Portemonnaie liegen, als wollten sie jederzeit sagen: ‚Los, überreich mich – ich erledige den Rest.‘
Und natürlich: Passbildfotos im Klarsicht-Tütchen –
Familie, Herzmenschen und Best Buddy in Portemonnaie kompatiblen Format. Gut geschützt, gut verstaut, gut fürs Herz.
Zwischen alledem liegt stets ein frischer Mundschutz. Nicht mehr aus Pflicht, aber aus Gewohnheit. Wenn Ela ein Ärztehaus betritt, setzt sie ihn auf wie andere den Hut ziehen. Eine leise Geste von Respekt, die irgendwo zwischen Pandemie-Reflex und liebevoller Routine hängen geblieben ist.
Falls du dich bis hierher fragst, was man in den Untiefen der Taschen nicht findet, kann ich dir darauf umgehend eine Antwort liefern:
Dies sind benutzte Taschentücher, klebrige Bonbonpapierchen, Flusen, Krümel. Oder sonstiger Unrat.
Organisiertes Chaos darf sein – aber nicht pappen oder bröseln.
Wer Ela dabei beobachtet, wie sie in ihrer Tasche sucht, könnte meinen, einer Mischung aus Zaubertrick und archäologischer Grabung beizuwohnen. Sie greift hinein – tief, entschlossen, mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen, der weiß: Es ist da. Irgendwo. Und ich werde es finden. Auch wenn ich dafür bis nach Narnia vordringen muss.
Ihr Umfeld sagt, man könne sie an genau dieser Handbewegung erkennen.
Das Wühlen mit Mission.
Die kleine Drehung am Henkel, der konzentrierte Blick, die Hand, die abtaucht, als gäbe es dort unten eine eigene Zeitzone.
Und auch wenn sie selten etwas auf Anhieb findet – am Ende findet sie es immer. Sie weiß, was sie besitzt. Sie ist sich stets zu 100% sicher, dass sie es eingesteckt hat.
Sie weiß nur nicht immer sofort, wo.
Wie im Leben.
Vielleicht ist das die heimliche Wahrheit ihrer zwei Taschen:
Sie sind nicht nur voll. Sie sind ein Spiegel. Eine kleine chaotisch-organisierte Welt, voller Herz, voller Pläne, voller spontaner Momente – und immer mit einem Funkeln in der Tiefe.
Sie besitzt die seltene Mischung aus Spontanität und Vorbereitung.
Wenn man Ela nur über ihre Taschen kennenlernen würde, könnte man glauben, sie sei jederzeit bereit, die Welt zu retten – oder wenigstens den Tag. Und vielleicht stimmt das sogar.
Dass sie chaotisch ist – aber organisiert.
Spontan – aber ausgestattet wie eine mobile Drogerie.
Empfindsam – aber bodenständig genug fürs Leben. Und zuverlässig wie des Schweizers Taschenmesser.
Denn sie ist eine Frau, die das Leben liebt.
Die für andere mitdenkt.
Die Menschen im Blick hat. Hunde sowieso. Die schreibt, beobachtet, sammelt, glitzert, denkt, sich sorgt, lacht, rettet. Eine Trägerin von Glückskastanien – und jemand, auf dessen Pflaster man sich verlassen kann.
Eine Frau, die – im schönsten Sinne – immer ein kleines Stück Welt mit sich herumträgt.
Eine Frau, die jederzeit losfliegen könnte – im Kopf und im Leben.
Mit zwei Taschen voller Impulshilfen.
Und einem Herz voller Geschichten.
Und wenn jemand fragt, ob all das wirklich sein müsse oder ob sie’s nicht ein wenig übertreibt, lächelt sie nur.
„Natürlich“ sagt sie dann.
„Man weiß ja nie.“
Heute
Ich trete hinaus in die Nacht, lasse die Tür hinter mir ins Schloss fallen, ohne noch einmal zurückzusehen.
Der Schlüssel liegt warm in meiner Hand, aber ich spüre, wie kalt die Luft um mich ist.
Ich gehe, weil ich es nicht mehr ertrage, zu bleiben.
Und ich bleibe, weil ich nicht anders kann. Ich frage mich: Wie lange noch?
Wie lange halte ich dieses Spiel noch aus?
Dieses Leben im Schatten. Dieses Warten auf ein Morgen, das nie kommt.
Ich atme tief ein. Dann wende ich mich ab.
Denn ich weiß: Ich kann alles ertragen – außer das, was ich gerade fühle.
Ich stehe hier, auf dieser Schwelle, und alles in mir schreit nach einer Entscheidung,
die ich nicht treffen kann.
Vier Jahre. Vier Jahre, in denen ich sein Schatten bin, seine Zuflucht – und seine Lüge.
Ich weiß, dass er mich liebt. Vielleicht nicht so, wie er sie liebt, aber genug, um mich immer wieder zu brauchen.
Und ich liebe ihn.
Gott, ich liebe ihn so sehr, dass ich bereit bin, mich selbst zu verleugnen.
Ich habe von Anfang an gesagt: keine Ansprüche. Keine Versprechen.
Kein Leben, das uns gehört. Aber mein Herz hat nie aufgehört, zu hoffen.
Ich habe ihm zugesehen, wie er ihr die Hand auf den Rücken legt. Wie er ihr den Mantel abnimmt, ihr einen Kuss auf die Stirn drückt – und ich habe erstickend meine eigene Schuld geschluckt.
Jeden verdammten Feiertag.
Ich sitze mit Beiden am Tisch, halte die Gabel in meiner Hand, und sehe in ihren Augen den Zweifel, der sie manchmal plagt.
„Ella, weißt du etwas? Ist da etwas, was ich nicht sehe?“
Und ich sage: „Nein. Du siehst alles. Er liebt dich.“
Weil ich weiß, dass er sie nie verlassen wird.
Weil ich weiß, dass ich nur ein sicherer Hafen bin, den er aufsucht, wenn er zu ertrinken droht.
Manchmal wünsche ich mir, ich könnte gehen. Das Teil, das trennt und eint aus meinem Herzen reißen und es in den Fluss werfen.
Aber ich bleibe.
Ich bleibe, weil ich nicht anders kann.
Ich bleibe, weil ich nicht weiß, wer ich bin, wenn er nicht mehr mit mir atmet.
Vielleicht bin ich feige.
Vielleicht bin ich süchtig.
Vielleicht liebe ich ihn so sehr, dass ich sogar mich und meine Prinzipien verrate.
Aufbruch
Die Straße ist leer, nur das gedämpfte Licht der Laternen auf dem Asphalt. Ich hole nur flach Luft, als könnte ich das, was eben noch war, wieder aus mir herauspressen.
Ich gehe ein paar Schritte, höre meine eigenen Schritte auf dem Pflaster wie ein Bekenntnis, das ich nicht aussprechen will. Dann bleibe ich stehen. Drehe mich doch noch einmal um. Schaue hinauf zu diesem Fenster im zweiten Stock, wo er noch vor einer halben Stunde meine Hände gehalten hat.
Wo er gesagt hat: „Ich muss jetzt gehen. Du weißt das.“
Ich habe genickt, weil ich immer nicke.
Weil ich es von Anfang an wusste.
Weil ich nicht seine Frau bin, nicht seine Familie – nur ein geheimer Teil von ihm, der seine Lungen wieder füllt, wenn er es nicht mehr kann.
Das Licht in diesem Zimmer ist längst erloschen. Vielleicht liegt er jetzt neben ihr. Vielleicht schläft er. Vielleicht spürt er noch immer mein Parfum auf seiner Haut.
Und ich stehe hier, mitten auf der Straße, mein Herz klopft gegen meine Rippen wie eine Antwort, die ich nicht hören will.
Ich frage mich: Wie lange noch? Wie lange halte ich dieses Spiel noch aus?
Dieses Leben im Schatten. Dieses Warten auf ein Morgen, das nie kommt.
Langsam löst sich die Szene von meiner Stimme, wird zur stillen Beobachtung:
Die Frau an der Wand
Ella schließt die Tür zu dem Zimmer so leise, dass selbst das Knarren des alten Gusseisen-Griffs klingt, als würde es ihr den Atem rauben. Ein einfacher Schlüssel, alt, mit Bart, der leise im Schloss einrastet. Kein Sicherheitsschloss. Kein Schutz vor dem, was hier geschieht.
Der Hausflur ist still, der dunkle Parkettboden unter ihren Füßen glänzt matt im Licht einer einsamen Glühbirne, deren Surren wie ein Herzschlag klingt. Kratzer im Holz, lange Linien, als hätte jemand hier schon einmal gewartet. Sie zieht den schwarzen Pullover enger, als könnte sie so den Geruch von ihm festhalten, den Abdruck seiner Hände in ihrem Rücken.
Das Zimmer, ihr Zimmer, ist ihr Zufluchtsort. Ein Käfig, ein Geheimnis. Die Matratze hoch, das Bett ein Nest aus zerknüllten schwarzen Laken, schwer von all dem, was hier immer wieder beginnt und nie endet. Keine Vorhänge vor dem Fenster – wozu, im zweiten Stock? Kerzen, deren Dochte rußig sind, als würden sie jede gemeinsame Zeit mitschreiben. Der Spiegel gegenüber vom Bett, alt, fleckig, in dem sie sich manchmal selbst nicht wiedererkennt, wenn sie seine Finger auf ihrer Haut spielen sieht, während ihre Augen sich darin treffen.
Das Bild an der Seitenwand – eine Frau im Schatten, von hinten, den Blick in die Ferne gerichtet. Es hing schon da, als sie das Zimmer das erste Mal betraten. Es erinnert Ella irgendwie an sich selbst. Sie haben es nie abgehängt. Es stört nicht. Es passt.
Rückkehr
Als Ella zurückkam, war es nicht nur der Schlaganfall ihres Vaters, der sie heimholte. Sie kehrte zurück. Zu ihrer Mutter, die seitdem jeden Tag etwas kleiner wirkte. Zu dieser Stadt, in der alles einmal begonnen hatte.
Es war auch dieses Gefühl, dass etwas in ihr zerbrochen war. Ihre Beziehung, die an der Distanz gescheitert war – zu einem Mann, der immer unterwegs war, so wie sie selbst auch. Er, ein Kameramann für einen Fernsehsender, genauso rastlos wie sie. Zwei Menschen, die sich nur in Hotelzimmern trafen, in Nächten, die immer wieder Abschied bedeuteten. Sie hatten versucht, das „zwischen uns“ zu retten, aber irgendwann mussten sie beide zugeben: Zwei, die nie bleiben, können nicht zusammen sein.
Jetzt war sie hier. In ihrer Stadt, in der alles einmal begonnen hatte. Auch der Kontakt zu Melli lebte wieder auf, langsam, wie ein leises Echo.
Melli, ihre beste Freundin von damals, ein Kontakt, der nie abgebrochen war, auch wenn er loser wurde. Melli, die Kunstgeschichte studierte. Zart, leise, mit einem Blick, der in Allem Schönheit fand.
Sie hatten sich an der Uni kennengelernt, in einer dieser typischen wilden Studentenpartynächte, in denen Melli zu viel getrunken und Ella sie heimgebracht hatte, bevor jemand anders es tat. Aus dieser Nacht wuchs eine Freundschaft, die alles aushielt – bis das Leben sie in verschiedene Richtungen zog.
Ella verließ die Stadt, folgte ihren Geschichten, während Melli blieb, in Räumen voller Farbe und Stille.
Sie erinnerten sich immer an diese Nacht, sprachen später oft darüber. Ella, die zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass sie sich in anderen Menschen verlieren konnte. Melli, die noch an die große Liebe glaubte, an das „Für immer“. Sie waren sich ähnlich und doch so verschieden.
Vernissage
Jahre später hatte Melli sie zu einer Ausstellung eines unbekannten Künstlers eingeladen, der mit seinen Bildern Verletzlichkeit und Sehnsucht so punktuell auf Leinwand bannte, dass man kaum wegsehen konnte.
Ein Abend, an dem in Bildern plötzlich alles vibrierte: Augenblicke.
„Du musst kommen, Ella“, hatte Melli gesagt. „Das ist so wie früher. Kunst, das sie dich lebendig werden lässt.“
Ella hatte gezögert. Doch etwas in Mellis Stimme hatte sie berührt. Also war sie gegangen, hatte sich treiben lassen durch die Räume voller Bilder, die wie flüchtige Gedichte an den Wänden hingen.
Ein Abend voller gedämpfter Stimmen, Gläser, in denen sich Licht brach.
Hier lernte sie nun auch endlich Johannes kennen.
Johannes, Mellis vielgerühmter Ehemann, von dem sie bisher nur gehört hatte. Johannes, CEO eines Softwareunternehmens, erfolgreich, organisiert, ein Mann, der Lösungen verkaufte und immer einen Plan hatte. Aber hinter seinen Augen lag etwas Unbestimmtes, Unklares, das ihr sagte: hier ist einer,
der nicht alles im Griff hat.
Er hatte sich für Melli entschieden, weil sie ihm ein Zuhause gab. Ihre Sanftheit weckte in ihm einen Teil, der nicht kämpfen musste. Mit ihr war er ruhig.
Als Ella ihn zum ersten Mal sah, war es Jahre nach dem Studium. Sie hatte Journalismus studiert, immer schon getrieben von dem Wunsch, Geschichten zu finden, die Wahrheit hinter den Fassaden zu entblättern. Sie war viel unterwegs, suchte Worte in Städten, die sie nie länger kannte.
Sie stand vor einem Gemälde – eine Frau, die den Kopf in den Nacken legte, die Augen geschlossen, als wäre sie bereit, sich allem hinzugeben. Johannes trat neben sie, sein Hemd lässig geknöpft, der Blick ruhig, fast kühn.
„Du magst das Bild?“, fragte er.
„Es ist ehrlich“, sagte Ella.
„Manchmal ist das das Mutigste, was man zeigen kann“, sagte er. Und sie wusste, dass er nicht von dem Bild sprach.
Vergangenheit
Bei der Hochzeit konnte sie nicht dabei sein – sie war am anderen Ende der Welt, als Journalistin einer großen Nachrichtenagentur gebunden an eine Story, die keinen Aufschub kannte.
Melli hatte ihr in einem ihrer endlosen Telefonate einmal anvertraut, dass Johannes der Mann sei, dem sie ein Zuhause geben konnte, der ihr dieses Zuhause nahm und es gleichzeitig festhielt.
Und Melli hatte ihr später Bilder geschickt: Johannes, der ihr den Schleier vom Haar nahm. Melli, wunderschön wie sie in ihrem weißen Kleid lachte, als könnte sie alles umarmen.
Monate später trafen sich Ella und Johannes bei der Babyparty für Mellis zweitem Kind wieder, das später ihr Patenkind wurde. Etwas, das sie schon zu Studienzeiten spielerisch ernst in endlosen Nächten festgelegt hatten. Als sich ihre Blicke an diesem Abend trafen, wussten sie beide, dass es kein Zurück mehr gab.
Johannes trat hinter sie, seine Stimme leise, rau: „Du gehörst nicht hierher.“
Ella hatte gelacht. „Und du? Glaubst du, du gehörst hierher?“
Er hatte nichts erwidert. Nur diesen Blick, so dunkel, dass sie sich darin verlor.
Da war kein Lächeln. Keine Ausflucht. Nur dieses stille Einverständnis:
Dass alles, was sie unausgesprochen zueinander zog, unausweichlich war.
Das Zimmer
Sie wurden zu Komplizen. Johannes’ Hände in ihrem Nacken, ihre Finger in seinen Haaren, ein Kuss, der kein Zögern kannte. Kein sanftes Liebemachen. Ein Kampf, ein Ringen, hart, verlangend. Danach lagen sie nebeneinander, verschwitzt, das Atmen wie ein Bekenntnis. „Du treibst mich in den Wahnsinn“, flüsterte er. „Dann lass uns untergehen“, sagte sie leise.
Manchmal fragte sie sich, wie lange sie dieses Spiel noch spielen konnten. Ob es irgendwann leichter würde, nicht immer an morgen zu denken.
Sie liebte ihn – nicht so, wie man ein Versprechen liebt, sondern so, wie man einen Augenblick liebt, der nie bleiben darf.
„Ich will dich nicht verlieren“, dachte sie. „Aber ich kann dich auch nicht festhalten.“
Er wusste, dass er sie nicht retten konnte, so wie sie ihn nicht retten konnte. Aber in diesen Stunden, wenn sie in seinen Armen lag, wenn sie ihren Kopf an seine Brust legte und er spürte, wie sie atmete – dann fühlte er sich weniger verloren.
„Ich kann dir nicht alles geben“, dachte er. „Aber ich kann dir diesen Moment geben. Und manchmal ist das mehr, als ich mir selbst zugestehe.“
An einem Nachmittag, als die Hitze ihrer Körper noch in der Luft hing, legte sie ihre Hand an seine Wange. „Sag mir, was du denkst“, flüsterte sie.
„Dass ich dich will. Und dass ich dich gehen lassen muss.“
„Du musst nicht. Nicht jetzt.“
„Aber irgendwann.“
„Irgendwann ist immer zu weit weg“, sagte sie. „Bleib hier. Heute reicht.“
Er legte seine Hand an ihre Wange, sein Daumen strich eine Spur über ihre Lippen. „Heute reicht.“ Und für diesen Moment glaubten sie beide daran.
Das Zimmer war ihr Geheimnis. Ein Ort, der nur ihnen gehörte.
Der Boden war dunkel, Narben im Holz, als wären sie selbst in ihn eingeritzt. Ein kleines Badezimmer, zwei Handtücher, immer ordentlich, immer frisch.
Wahrheit
Vier Jahre ist das jetzt her. Vier Jahre, in denen sie gelernt haben, den Schmerz zu lieben.
Ella sitzt oft bei Melli, das Patenkind auf ihrem Schoß, das kleine Gewicht, das ihr Herz weicher macht
und zugleich bricht.
Sie – die beste Freundin, die Patin, die Geliebte, das Teil des Lebens, das nicht sein darf.
Sie sitzt am Tisch, an Weihnachten, mit dem kleinen Patenkind auf dem Boden und packt raschelnde Geschenke aus. Lächelt, während ihr Herz sie auffrisst.
Er sitzt neben seiner Frau, lacht, als wäre nichts.
Nur wenn ihre Blicke sich treffen, ist da dieses kurze Aufflackern von Wahrheit –
bevor sie wieder die Masken aufsetzen.
Als Ella das zerfledderte Papier des letzten Weihnachtspäckchens in den dafür vorgesehenen Korb knüllt, fällt ihr Blick auf einen schlichten und doch edel verpackten großen Umschlag, auf dem ihr Name steht.
Sie greift danach, schaut auf und blickt zwischen Johannes und Melli fragend hin und her.
„Für mich?“, ein Hauch von Überraschung schwingt in ihrer Stimme.
„Ja“, sagt Melli und hebt kurz die Augenbrauen, ein Schimmer von Neugier darin.
„Mach schon auf. Ich bin so gespannt, wie es dir gefällt.“
Ella öffnet vorsichtig die Verpackung, während Melli plappert: „Ich habe es zufällig in dieser bezaubernden Buchhandlung neben dem Kaufhaus gefunden, in der wir früher so oft und gerne gestöbert haben. Weißt du noch?!
Da fand gerade die Lesung einer Jungautorin statt, die ihren Debüt-Lyrikband vorstellte. Als sie vorlas, hat es mich sofort an dich erinnert – wie du fühlst, wie du schreibst. Ich musste es einfach mitnehmen.
Ich weiß, es passt zu dir.“
Ella hält das Buch in den Händen, betrachtet den Einband und liest den Titel:
„HERZZEITLOS – Gedichte, die atmen. Ehrlich – roh – und voller Seele“.
Sie beginnt zu blättern und bleibt an einem Gedicht hängen:
INTIMITÄT
„Die Versuchung ist groß,
das Echo deiner Nähe zu formen –
nicht mit Lauten,
sondern mit allem,
was zwischen Haut und Atem liegt.
Ich sende dir mein Spüren,
und warte,
bis du zurückhallst.
Nicht als Antwort.
Sondern als Zeichen,
dass du mich fühlst.“
Ella liest es, liest es noch einmal – und fühlt jedes Wort, als würde es ihre eigenen Gedanken fassen.
Dann legt sie den Gedichtband auf ihren Schoß, hebt den Blick und sieht die beiden an,
die ihr Herz so gegensätzlich und doch so vollständig füllen.
„Und wie es passt“, sagt sie schließlich, ihre Stimme fest. „Danke… ich danke dir sehr.“
Wortlos
Manchmal glaubt Ella, dass dieses Zimmer sie auffrisst.
An einem Abend hört sie das Knarren im Flur, spürt einen Schatten, der nicht seiner ist.
Ein Geräusch, das zu fremd klingt, um Einbildung zu sein.
Sie wagt nicht, sich umzudrehen, hält nur seine Hand fester, die Stirn an seiner Schulter.
„Hast du das auch gehört?“, fragt sie, die Stirn in Falten.
„Vielleicht.“
„Vielleicht… oder ja?“
Er schweigt. „Ich weiß es nicht.“
„Was wäre, wenn jemand wüsste, was wir hier tun?“, flüstert sie.
„Dann wäre es wahr“, sagt er. „So, wie es jetzt schon wahr ist. Aber wir würden es nicht mehr leise leben können.“
„Würdest du es dann lassen?“
Sein Blick ist dunkel, fest, als er eine Haarsträhne, welche über ihren Augen liegt, beiseiteschiebt.
„Ich weiß nur, dass ich dich immer wieder suchen würde. Ob es jemand sieht oder nicht.“
Sie nickt. „Ich auch.“
Doch als er geht, brennt diese Frage in ihr: Was wäre, wenn jemand sie gesehen hat?
Was wäre, wenn das alles auffliegt?
Diese Fragen nagen an ihr wie ein zweiter Herzschlag, immer da, immer lauter.
Er verlässt das Zimmer, wie immer: wortlos, leise, sein Schlüssel dreht sich im Schloss.
Melli
Eines Morgens liegt der Roman „Club der toten Dichter“ von Nancy H. Kleinbaum auf Mellis Küchentisch. Ein Geschenk von Ella, vor Monaten, mit einer Widmung: „Für all das, was wir teilen, ohne es auszusprechen.“ Melli lächelt, als sie das Buch in die Hand nimmt, und sich daran erinnert, wie Ella es ihr damals mit den Worten überreicht hat: „Weißt du noch, wie Professor Hugenpoet aus dem Seminar ‚Europäische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts‘ immer sagte: ‚Carpe Diem – nutze den Tag‘? Du hast doch immer gesagt, dass er dich an Professor John Keating aus ‚Club der toten Dichter‘ erinnert hat – inspirierend, unkonventionell, wie wir’s immer wollten.“ Es war der einzige Kurs, den Melli und Ella damals gemeinsam an der Uni belegten – ein Kurs, der mehr war als nur Theorie, mehr als nur Literatur.
Martha, ihre Haushälterin hatte das Regal ihrer kleinen Bibliothek abgestaubt, alle Bücher heruntergenommen, und dieses Exemplar wohl vergessen, wieder einzuräumen. Jetzt liegt es da, mitten auf dem Tisch, als wäre es ein Gedanke, der plötzlich Form angenommen hat.
Melli streicht mit den Fingern über den Einband, denkt an die Freude, die sie damals empfand – und an all die Jahre Freundschaft, die Ella und sie verbindet.
„Das muss ich Ella zeigen, wenn sie heute Abend zum Essen kommt“, denkt sie. Sie hat Ella eingeladen, weil Johannes auf einem Kongress ist und erst spät in der Nacht zurückkommt. „Du warst schon lange nicht mehr hier“, hatte Melli gesagt. „Lass uns mal wieder quatschen, wie früher.“
„Ich bring die Kinder auch früh zu Bett.“
Carpe Diem
Ella hatte kurz überlegt, dann zugesagt. Weil sie wusste, dass diese Abende wie eine Beruhigung waren
– und zugleich ein leises Gift.
Als sie hereinkommt, riecht es nach frischem Brot, nach Wärme. Melli deckt den Tisch, während Ella die Jacke
ablegt.
Melli nimmt das Buch vom Ecktisch, lächelt. „Schau mal, was ich heute wieder entdeckt habe“, sagt sie. „Martha hat das Regal abgestaubt und dieses Buch einfach liegen lassen. Und sofort musste ich an den Abend denken, als du es mir geschenkt hast – mit den Worten von Professor Keating. Weißt du noch?“
„Carpe Diem“ schmunzelt Ella. Melli lacht leise. „Ich habe mich damals so darüber gefreut.“
Sie blättert gedankenlos darin, die Finger verweilend über einer Zeichnung. Dann hält sie inne, zieht ein leicht vergilbtes Blatt hervor – unscheinbar, mit einem einzigen Wort in Schreibmaschinenschrift getippt: „geheim“. Kein Absender, kein Hinweis. Nur dieses eine Wort, das in der Luft steht wie ein unausgesprochenes Geständnis.
Melli dreht den Zettel und sieht Ella an. „Schau mal hier, ein Lesezeichen?! Keine Ahnung, woher.
Vielleicht von dir?“
Ella spürt, wie ihr Herz einen Moment lang stillsteht, als sie liest, was darauf steht. „Nein. Ich habe das Buch so gefunden – auf einem Flohmarkt. Vielleicht hat sein Vorbesitzer ihn hineingelegt.“
„Es ist nur ein Wort, jedoch… findest du nicht, dass es wie ein Versprechen klingt? Oder ein Bekenntnis.“
Melli betrachtet das „geheim“, legt das Fundstück langsam beiseite.
„Aber jetzt erzähle du, was machst du aktuell? Wie geht es deinen Eltern? Hast du den Artikel von dem rothaarigen Politiker fertig, wie war nochmal sein Name?“ Ella gab ihr bereitwillig Auskunft zu Ihren Fragen.
Melli wirkt zufrieden und nimmt einen Schluck Wein. „Weißt du, ich habe neulich jemanden gesehen…“
Ella hebt den Kopf, spürt, wie ihre Kehle trocken wird. „Jemanden?“
„Ja. Ich weiß nicht, warum – aber ich musste unwillkürlich an dich denken. Nicht direkt, aber… es war etwas in seinem Blick. So… verloren. Und gleichzeitig so entschlossen.“
Ella versucht, ruhig zu bleiben. „Und was hast du gedacht?“
Melli lächelt sanft. „Dass ich diesen Blick kenne. So, als würde jemand alles für einen Moment geben
– selbst wenn er ihn nicht behalten kann.“
Sie legt den Kopf schief. „Du hast manchmal auch diesen Blick, Ella. Als würdest du immer ein bisschen kämpfen.“
Ella schweigt. Sie spürt, wie sich alles in ihr verhärtet und zugleich wie feinstes Porzellan zu zerbrechen droht.
„Vielleicht habe ich das nur geträumt“, sagt Melli dann. „Manchmal spielt einem der Kopf ja Streiche…“
Ella nickt, ein stummes Nicken, das alles sagt und nichts verrät.
Und in diesem Moment weiß sie, dass dieser Abend für immer in ihr bleiben wird – so wie dieses eine Wort: „geheim“.
Ella
Leise und Laut
Ich habe nie geglaubt, dass man sich so sehr verlieren kann, ohne sich selbst dabei zu verlieren.
Doch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, spüre ich, wie mein Herz sich enger zieht.
Ich liebe alles an ihm – selbst das, was an ihm nicht liebenswert ist.
Ich liebe, wie er riecht, wie er denkt, wie er mich ansieht, als wäre ich das Einzige, was er in diesem Moment braucht.
Seine Entschlossenheit.
Dieses unnachgiebige, männliche, das mich gleichzeitig so anzieht und so kaputtmacht.
Er kann verletzend sein.
Er kann diese Sätze sagen, die mich zerreißen, nur um sich selbst zu retten.
Ich weiß, dass er damit kämpft – dass er sich selbst nicht mehr leiden kann in diesen Momenten.
Aber ich kann ihn nicht einfach loslassen.
Weil ich weiß, dass unter dieser Härte eine Zärtlichkeit verborgen ist, die mir gehört.
Vielleicht nicht für immer – aber für diese Augenblicke, in denen er nur mich will.
Und manchmal frage ich mich:
Bin ich nur sein Rückzugsort?
Bin ich nur die Frau, die er beißt, weil er nicht schreien darf?
Johannes
Schweigen.
Er liebt seine Frau.
Er liebt die Kinder, die sie ihm geschenkt hat.
Aber Ella ist etwas anderes.
Kein Zuhause – ein Sturm.
Etwas, das ihn lebendig lässt, wenn er sich selbst nicht mehr spürt.
Und er hasst sich dafür, dass er es immer wieder braucht.
So wie er ihre Blicke hasst, wenn sie ihn durchschauen.
So wie er liebt, dass sie ihn hält, auch wenn er sich selbst nicht halten kann.
Er denkt: Ich gehe abends nach Hause, wie ich es immer tue.
Zu meiner Frau, meinen Kindern, meinem Leben, das so geordnet ist, dass es mir fast schon Angst macht.
Es ist nicht perfekt – das ist es nie gewesen.
Aber es ist mein Zuhause.
Es sind meine Kinder, die mich brauchen.
Es ist diese Frau, die mir zwei Leben geschenkt hat, die ich nicht verraten will.
Und dann ist da Ella.
Ella mit diesem Lächeln, das ihn in den Wahnsinn treibt.
Mit dieser Wärme, die ihn anzieht, weil er sie sonst nirgends findet.
Mit diesem erkennenden Blick, der ihn entlarvt, noch bevor er selbst weiß, was er eigentlich fühlt.
Ella, die alles an ihm liebt, selbst die Ecken, die seine Frau nicht mehr sehen will.
Ella, die er hält, wenn er es selbst nicht mehr aushält.
Er liebt sie.
Nicht so, wie er seine Frau liebt.
Aber er liebt sie trotzdem.
Vielleicht liebt er in ihr auch die Teile von sich, die er nicht zeigen darf.
Dieses Feuer, diese Lust, diese Unruhe.
Er will das alles nicht aufgeben.
Er will seine Familie nicht verlieren.
Und er weiß, dass er sich irgendwann entscheiden muss.
Aber heute nicht.
Heute hält er sie fest, bis er wieder loslassen muss.
Bis er wieder dieser Ehemann ist, der abends heimkommt, als wäre nichts gewesen.
Und er fragt sich:
Wie lange noch?
Wie lange, bis sie ihn darum bittet, zu bleiben?
Wie lange, bis er nicht mehr sagen kann, dass er alles haben will, ohne alles zu zerstören?
Offen
Wie lange kann ich noch so tun, als wäre es nicht auch mein Untergang?
Wie lange, bis dieses Spiel nicht mehr nur uns gehört?
Wie lange, bis alles, was wir heimlich leben, zu laut wird, um es noch zu verbergen?
Sie weiß keine Antwort.
Aber sie weiß, dass sie ihn morgen wiedersehen wird.
Dass sie wieder diese Tür öffnen wird – und dass sie nicht anders kann.
Und als sie noch einmal den Blick hebt, sucht sie das Fenster des Zimmers im zweiten Stock.
Für einen kurzen Moment scheint das Licht darin zu flackern.
Nur ein Atemzug – und doch genug, um alles wieder spürbar zu machen.
Alles, was sie sind.
Alles, was sie nie sein dürfen.
Vor ihr die Nacht, dunkel und lautlos.
Hinter ihr das Zimmer, das alles weiß.
*****
V O R S A T Z
Es ist nicht von heute auf morgen passiert. So verliert man sich nicht.
Nennen wir es, schleichenden Prozess. Einer, in den ich hineingewachsen bin, ohne es zu merken.
Ich wurde vorsichtiger.
Habe Sätze abgemildert, bevor sie überhaupt den Mund verlassen durften.
Habe genickt, obwohl etwas in mir längst den Kopf schüttelte.
Habe Verständnis gezeigt, wo mir Respekt gefehlt hat.
Geduld, wo Grenzen nötig gewesen wären.
Anpassung, wo ich mich selbst verlor.
Zuerst habe ich weniger gefühlt. So nicht gar nicht. Aber gedämpft. Als läge etwas zwischen mir und dem, was mich eigentlich berühren sollte.
Ich war sonst nah.
Wach für Zwischentöne.
Aufmerksam. Zugewandt. Intuitiv.
Auch mal chaotisch – in Beziehung mit mir und der Welt.
Ich habe entschieden, wenn es sich richtig anfühlte.
So war ich immer gewesen. Doch genau das, griff nicht mehr. Dieser Zugang ging mir verloren.
Nicht, weil ich ihn verlernt hätte. Sondern weil er sich Stück für Stück zurückgezogen hat.
Ein Blick wurde flüchtig. Ich sah – aber ich erkannte nichts mehr wirklich. Ich schaute hin und sah doch vorbei. Da war ein Gesicht, aber keine Verbindung. Mein Blick wich meinem Spiegelbild aus. Meine Schultern sanken.
Geräusche erreichten mich, aber sie blieben außen. Stimmen. Musik. Worte. Alles da, nichts nah. Geschmack verlor an Tiefe. Essen sättigte - der Genuss blieb aus.
Gerüche zogen vorbei, ohne Erinnerungen in mir auszulösen.
Zuerst waren da Tränen.
Dann Hoffnungslosigkeit.
Dann Selbstzweifel.
In dieser Reihenfolge.
Und irgendwann nichts mehr.
Ich schnitt mich in den Finger. Nicht absichtlich. Und wartete instinktiv auf den Schmerz. Er kam nicht.
Ich hatte nichts falsch gemacht. Und trotzdem gab es keinen nächsten Schritt. Kein Gespräch. Keine Entscheidung. Keine Aktion, die wirklich etwas verändert hätte. Ich hörte mir - so simpel es klingt, selbst nicht mehr zu. Dieses innere Flüstern, das sagt, wenn etwas nicht stimmt. Ich überging es. Nicht einmal bewusst. Eher, aus der Übung.
Dabei habe ich mich selbst verloren. Nicht dramatisch. Gründlich. Und konsequent. Wenigstens das blieb.
Ich wurde vernünftig. Angepasst. Belastbar. Ich hielt aus. Ich machte weiter. Und ließ mich dabei immer mehr, ein Stück zurück.
Manche Phasen lassen sich nicht absichern. Nicht kontrollieren. Nicht beschleunigen. Sie bleiben offen. Und genau das ist ihr Wesen.
Gab es einen Augenblick, der alles veränderte? Ein Aufwachen? Einen Urknall? Keinen Knall.
Es war ein Gespräch. Nicht wichtig. Aus dem Ohrenwinkel. Nicht besonders. Alltag.
Jemand sagte etwas über mich. Nicht brutal. Nicht böse. Aber falsch.
Früher hätte mich das getroffen. Ich hätte widersprochen. Korrigiert. Oder zumindest innerlich aufbegehrt. Ein kurzer Stich. Ein inneres: Moment mal.
Diesmal nichts.
Ich hörte den Satz. Nickte im Automatismus. Ich antwortete ruhig. Sachlich. Beiläufig. Ich sah mich selbst sprechen und erkannte mich nicht.
Kein Puls. Kein Ziehen. Keine Hitze. Keine Gegenbewegung. Nur diese glatte, saubere Reaktion. Wie auswendig gelernt.
Das Gespräch ging weiter. Ich funktionierte. Ich war höflich. Ich war angemessen.
Und plötzlich traf mich nicht der Satz. Sondern meine Reaktion darauf. Oder genauer: ihr Ausbleiben.
Ich dachte nicht: Das ist klug von mir.
Ich dachte: „Egal.“
Und genau dieses Wort zog mir den Boden unter den blankgeputzten Schuhen weg.
Nicht egal im Sinne von souverän. Nicht egal aus Freiheit. Sondern egal, weil nichts mehr von mir da war, was reagieren wollte.
In diesem Moment stand ich innerlich still. Ich hörte zu – und war nicht da.
Unanwesend.
Und dann diese Frage, so klar, dass sie fast weh tat:
Wo ist der Mensch geblieben, der lacht, ohne sich zu bremsen?
Der liebt, ohne sich zu schützen?
Der wütend wurde, wenn etwas nicht stimmt?
Der sich zeigt?
Ich suchte und fand … nichts.
Weder Schmerz noch Wut. Keine Traurigkeit. Nur Leere.
Und dieses flächige - egal.
Es gab einen Geschmack in meinem Mund. Metallisch. Fast wie Blut – nicht real, aber nah genug, um zu wissen: Hier ist etwas verletzt.
Da wusste ich: So geht es nicht weiter. Nicht, weil etwas passiert war. Sondern weil nichts mehr passierte.
Das war kein Entschluss. Kein Vorsatz. Kein Plan.
Es war ein innerer Aufschrei ohne Laut.
Ich fühlte nicht.
Ich fühlte mich ganzundgarnicht.
Ich wollte wieder empfinden. Nicht gedämpft. Nicht gefiltert.
Lebendig. Liebend. Auch mal zornig.
Nicht aus Abrechnung. Sondern aus Ehrlichkeit.
Begreifen nahm mich bei der Hand. So will ich nicht reagieren. So will ich nicht agieren. So bin ich nicht.
Und dann, fast beiläufig, begann etwas zurückzukommen. Ich blieb vor einem Schaufenster stehen. Grundlos. Mein Blick blieb einfach hängen.
Da war ein Mensch. Mir fremd. Und doch vertraut. Ich erkannte ihn erst nicht. Weil ich ihn schon so lange nicht mehr gesehen hatte. Ein Freund aus alten Zeiten. Dann dieser Moment. Zögernd. Ein leises: Ach…
Da war ich wieder. Nicht vollständig. Nicht wie früher. Aber da.
Ich stieß mich an. Unachtsam. Mit dem Schienbein an einer Kante. Der Schmerz kam sofort. Scharf. Ehrlich. Und ich stand da und dachte: Hi
Auf dem Markt reichte mir jemand einen Pfirsich. Einfach so. Ich biss hinein. Unüberlegt. Der Saft lief mir am Mundwinkel entlang. Dieser Geschmack. Süß. Saftig. Die Schale leicht pelzig auf der Zunge.
Ein Lied blieb vor sich hinsummend hängen. Statt vorbeizuziehen. Ich hörte mir selbst wieder zu. Aufrichtig. Authentisch.
Manche Schritte zeigen sich erst, wenn man aufhört, sie zu erzwingen.
Und in diesem Bruchteil von drei Sekunden, wusste ich:
Ich bin zurückgekommen.
Nicht über Worte.
Nicht über Vorsätze.
Sondern über Schmerz. Klang. Blick. Geschmack.
Ich schulde mir selbst Respekt.
Ich kehre zurück zu mir.
Ich mache mich nicht mehr klein.
Ich habe eine Stimme.
Das ist kein Manifest. Kein inneres Tribunal. Es ist ein Wiederfinden.
Und das ist mein Vorsatz.
Der bleibt.
Ich schulde mir das.
Ich lasse mich nicht noch einmal zurück.
Genug.
Gabriele Ela Schellinger
Mein Leben lädt. Bitte warten.
Ich war beim großen A. Mein Handy hatte sich ständig aufgehängt. Eingefroren. Reaktionslos. Dinge, die man ignoriert, bis sie sich nicht mehr ignorieren lassen. Ein Ort aus Glas und Beruhigung. Menschen, die das hier jeden Tag machen. Ruhig. Routiniert. Handgriffe, die sitzen. Alles wirkt kontrolliert, eingeübt, professionell. Sätze, die nichts dramatisieren. Sätze, die versprechen, dass nichts passiert.
„Nur ein Softwarefehler.“ Ein Satz wie Watte. Ein Satz wie Narkose.
„Wir haben alles in der iCloud gesichert.“
Wir fahren jetzt alles runter. Wir resetten das Gerät. Alles ist gesichert.
Fünf Minuten später war mein Leben weg.
Nicht langsam. Nicht schleichend. Nicht mit Zeit, zu begreifen.
Ein Klick. Ein Flackern. Ein leerer Bildschirm.
Etwas in mir sackte ab. Nicht bildlich. Körperlich.
Meine Augen rissen auf. Unwillkürlich. Zu weit. Als wollten sie greifen. Als könnten sie festhalten, was gerade fällt.
120 Fotos. Von 60.000.
Mein Atem blieb stehen. Ein kompletter Stillstand. Dann kam er zurück – stoßweise, unkontrolliert, zu schnell für einen Körper, der begreift, dass er nichts mehr steuern kann.
Keine Notizen. Kein Adressbuch. Kein Kalender.
Sieben Jahre waren weg.
Nicht gelöscht. Nicht verbrannt. Nicht zerstört.
Einfach: ausgelöscht aus der Gegenwart.
Mein Herz begann zu rasen. Nicht romantisch. Nicht metaphorisch. Ein hartes, panisches Schlagen, als würde es gegen etwas Unsichtbares rennen. Als müsste es beweisen, dass ich noch existiere.
Das Backup, sagten sie, sei erfolgreich gewesen. Erfolgreich wohin, fragte mein Körper, während mein Kopf sich auflöste.
Mein Handy zeigte mir 2018. Ein falsches Leben. Ein anderes Ich. Menschen, die tot sind. Menschen, die gegangen sind. Termine, die nichts mehr mit mir zu tun haben.
Meine Hände wurden nass. Schweiß brach aus – kalt, unangekündigt, peinlich real. Die Haut rutschig, als gehörten sie jemand anderem.
Dann die Passwörter.
Drei Stück. Alle richtig. Und keines gültig.
Ich hörte mein Blut rauschen. Ein dumpfes Dröhnen im Kopf. Meine Ohren wurden heiß. Mein Nacken spannte sich so sehr, dass es brannte.
Das Passwort für Apps. Das Passwort für irgendwas. Und eines für die Apple-ID, das ich irgendwann einmal wusste, als mein Kopf noch geordnet war, als ich noch glauben durfte, dass Systeme verlässlich sind.
Ein Techniker wurde dazugeholt. Einer extra. Er schaute ruhig auf das Gerät, sachlich, ohne Hast. Sagte, das komme vor. Selten, aber es komme vor. Vielleicht bei einem von fünfhundert.
Warum immer ich, dachte ich, aber die Frage blieb irgendwo stecken, zwischen Kehle und Brust.
Hier könne man jetzt nichts mehr tun. Ich müsse nach Hause fahren. Es dort über meinen Computer versuchen. Vielleicht über meine externe Festplatte. Vielleicht ließe sich dort wenigstens noch retten, was bis gestern war.
Ein Kribbeln kroch meinen Rücken hoch. Wie Strom. Wie eine Warnung. Meine Haare stellten sich auf. Mein Körper erlag meiner Frustrationsgrenze längst, während ich noch versuchte, ruhig zu bleiben.
Eineinhalb Stunden später fuhr ich nach Hause. Alleine. Mit einem „geschrotteten“ unbrauchbaren Etwas, was mein Hiersein bestätigte.
Mit diesem Satz im Ohr, der sich festsetzte wie ein Dorn:
„Das müssen Sie jetzt selbst machen.“
Ohnmacht drückt auf die Brust. Wie ein Gewicht. Wie eine Hand, die nicht loslässt. Mein Mund war trocken. Der Geschmack bitter, schwarz, unbrauchbar – wie kalter Kaffee von der Warmhalteplatte, der nichts mehr tröstet.
Angst hat einen Geschmack.
Zu Hause lag das Handy am Ladegerät. Reglos. Fremd. Wie ein Körper, der nicht antwortet.
16 Stunden verbleibend.
Mein Leben lud. Bitte warten.
Ich saß daneben, und mein Herz schlug zu schnell für einen Raum, in dem nichts passierte.
Mein Magen zog sich zusammen. Ein harter Knoten. Ein Schmerz ohne Ort. Mir war kalt und gleichzeitig zu heiß.
Dann wollte es eine Bestätigung.
Meine Finger zitterten. Nicht sichtbar. Aber ich spürte es. Jeder Muskel unter Spannung. Ich tippte, als hinge etwas davon ab. Tat es auch.
Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.
Mir wurde schwindelig. Kurz. Heftig. Als würde der Boden kippen.
Erneut versuchen. Prüfung fehlgeschlagen. Erneut versuchen.
Mein Atem ging jetzt falsch. Zu hoch. Zu schnell. Ich bekam nicht genug Luft, egal wie tief ich zog.
Ich faltete die Hände. Nicht aus Glauben. Aus nackter Angst.
Bitte. Bitte bitte bitte. Nicht alles. Nicht so. Nicht jetzt.
Gänsehaut überzog mich. Arme. Nacken. Rücken. Als hätte jemand Eis über mich gegossen. Mein Körper wollte fliehen, aber es gab keinen Ort.
Ich wartete.
Nicht aus Geduld. Nicht aus Hoffnung.
Aus Starre. Totaler Kontrollverlust.
Und irgendwo zwischen WLAN-Balken und Prozentanzeige, zwischen dem leisen Summen des Ladegeräts und dem viel zu lauten Schlagen meines Herzens, verstand ich:
Erinnerung ist verletzlich, wenn sie ausgelagert ist.
Kontrolle ist eine Illusion.
Und Panik sitzt nicht im Kopf. Sie wohnt im Körper.
Mein Leben lädt noch. Vielleicht vollständig. Vielleicht verstümmelt.
Ich sitze daneben, atemlos, wach, und warte, ob es zurückkommt.
Wir werden sehen.
Gabriele Ela Schellinger

Wortkrümel gefällig?
Wir verwenden Cookies - kleine Krümel für dein digitales Lesevergnügen. Sie helfen uns, deine Reise durch Herzzeitlos noch schöner zu gestalten. Keine Sorge, wir speichern keine Geheimnisse und ganz sicher nicht dein Krümelverhalten auf dem Sofa oder im Bett.